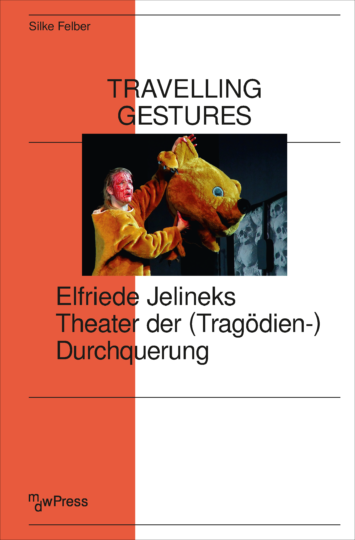Zitieren
Zitieren
Die Veruneindeutigung zwischen Komischem und Tragischem, die Jelinek mit ihren Theatertexten produziert, lässt sich nicht nur hinsichtlich der Arbeiten des Aristophanes nachweisen. Sie äußert sich auch mit Blick auf die antike Tragödie. Während wir innerhalb der Komödie paratragische Verfahren ausmachen können, finden wir umgekehrt in vielen Tragödien poetische Techniken vor, die durchaus als parakomisch zu bezeichnen sind. In seiner Dissertation Euripidean Paracomedy zeigt Craig Jendza, »that tragedians used paracomedy as a poetic technique in their plays much more frequently than is commonly believed […].«201 Der Begriff der paracomedy verweist hier auf die komische Strategie der Aneignung von Handlungen bzw. Szenen einzelner Komödien oder ihrer sprachlichen Merkmale.202 Ich wiederum möchte vorschlagen, den Begriff des Parakomischen auszuweiten auf texttheatrale Elemente und ästhetische Verfahren innerhalb der Tragödie, die die Unterscheidung zwischen Tragischem und Komischem auf eine ähnliche Weise unterminieren, wie dies die als paratragisch bezeichneten Strategien des Aristophanes tun. Tatsächlich nutzen alle drei großen Tragödienschreiber komische Verfahren, und zweifellos taten dies auch andere Tragödienschreiber, wenngleich wir aufgrund des fragmentarischen Charakters ihrer Stücke nicht die Möglichkeit haben, diese hinlänglich zu rekonstruieren. Unterschiedlich ist jedoch zweifelsfrei das Ausmaß, in dem Aischylos, Sophokles und Euripides auf die Komödie zurückkommen. Bei Aischylos und Sophokles offenbart sich dies hauptsächlich in der Sprache.203 Euripides wiederum übernimmt neben der Sprache auch Szenen und Handlungen einzelner Komödien. Darüber hinaus – und das erscheint mir aus theaterwissenschaftlicher Sicht besonders interessant – rekurriert er auch in metatheatraler Manier auf aufführungsspezifische Details wie das Kostüm.
Inwiefern die Grenzen zwischen Tragischem und Komischem bei Euripides brüchig werden, zeigt sich sehr eindrücklich in Der Wahnsinn des Herakles.204 Zur Erinnerung: Dank seiner intuitiven frühzeitigen Heimkehr nach Vollrichtung der Arbeiten gelingt es Herakles zunächst, die Tötung seiner Familie zu vereiteln und den mörderischen Plänen seines Gegners Lykos zuvorzukommen. Er erschlägt den Usurpator und macht sich daran, ein Opfer vorzubereiten, das ihn von dieser letzten gewaltigen Heldentat reinigen soll. Just aber als Herakles das Scheit ins heilige Wasser tauchen will, befällt ihn der von der Wutgöttin Lyssa bewirkte Wahn und verkehrt seine Humanität mit einem Schlag in ihr absolutes Gegenteil. Kaum eine Passage hat in der Philologie für so viel Ratlosigkeit gesorgt wie der Botenbericht des Dieners, der diesen Moment schildert:205
Diener:
Unser Haus zu entsühnen von Lykos’ Blut,
Trat Herakles hin zum Altar, umringt
Von den blühenden Kindern, von Vater und Weib,
Und schweigend wurde der Korb gereicht.
Schon taucht er ins heilige Wasser das Scheit,
Da hält plötzlich er inne und alles schaut hin
Auf verstummenden, ganz verwandelten Mann,
Der die rotgeäderten Augen rollt;
Aus dem Bart troff Schaum.
Und er lachte verstört: »Ach, Vater«, so rief er, »was töt ich vorher
Nicht Eurystheus und spare gedoppelte Müh?
Fort mit Krügen und Korb! Bringt den Bogen her
Und die Keule und Hebel und Brechgerät!
Nach Mykenä gehts! Was Kyklopen gefügt
Und geglättet, das bringen die Eisen zum Fall.«
Und er sprang auf den Wagen, den niemand sah,
Und schritt nur, und lenkte mit leerer Hand.
Ein Gespött und ein Schreck! Wir sahen uns an
Und fragten uns: »Scherzt oder rast unser Herr?«
[…]206
Die Verunsicherung des Dieners ergibt sich aus den scheinbar gegensätzlichen emotiven Signalen, die Herakles aussendet. Psychophysiologische Indizien wie die rotgeäderten Augen und der schäumende Mund legen nahe, dass sich Herakles in Raserei befindet. Sein Lachen aber steht aus Sicht des Dieners in irritierendem Kontrast zur gewaltgeladenen Stimmung der Situation. Aus neurobiologischer Sicht kann das Verhalten des Herakles auf eine Schädigung des Hypothalamus hindeuten, der bei Erheiterung normalerweise aktiviert wird. Die Schädigung dieser Hirnregion jedoch löst potenziell epileptische Anfälle oder auch Kataplexien verbunden mit Lachen aus.207
Mit Freud lässt sich hinter dem Lachen des Herakles eine »Ersparung an Hemmungs‐ oder Unterdrückungsaufwand«208 vermuten, die jenem Lustgewinn entspricht, den Freud im Hinblick auf den tendenziösen Witz bestimmt.209 Die von Herakles vormals »zur Hemmung verwendete Besetzungsenergie« zeigt sich nunmehr als »überflüssig […], aufgehoben und darum zur Abfuhr durch das Lachen bereit.«210 Dieses Lachen entsteht Freud zufolge, »wenn ein früher zur Besetzung gewisser psychischer Wege verwendeter Betrag von psychischer Energie unverwendbar geworden ist […].«211 Solch eine Lesart gibt den Lachanfall des Herakles als einen Akt der »Ersparnis« zu erkennen – der »Betrag von psychischer Energie« wird »durch die Aufhebung der Hemmungsbesetzung« abgelacht.212
Aus theaterwissenschaftlicher Perspektive wiederum markiert das verstörte und verstörende Lachen des Herakles nicht mehr und nicht weniger als die prekäre Verfasstheit des tragischen Subjekts. Die Differenz zwischen Helden und Wahnsinnigem, zwischen Kulturstifter und Kindermörder wird in diesem Lachen veruneindeutigt, und zwar durch eine herausragende dramaturgische Spielart des Euripides, die darin besteht, zu viele bzw. zum Teil gegensätzliche Informationen zu liefern und dadurch rezeptive Verunsicherungen zu provozieren. Der Altphilologe Richard Buxton hält diesbezüglich fest: »More even than Aeschylos or Sophocles, Euripides loves to force his audience to look at an action first from one perspective, and then from a different and contrasting one, so that their original assumptions about, for example, character have to be reassessed […].«213 Ähnliches konstatiert Thalia Papadopoulou. Sie spricht von einem »overflow of information«, mit dem Euripides sein Publikum konfrontieren und dadurch Verstörung stiften würde.214
Mit einem Informationsüberfluss haben wir es auch angesichts der Herakles‐Fortschreibung Wut zu tun, in der Jelinek gemäß dem typischen Verfahren zahlreiche unterschiedliche Bedeutungsstränge verwebt und dadurch eine Überforderung bei den Rezipient*innen ihrer Texte provoziert. Auch hier resultiert die Verunsicherung vornehmlich aus der unkommentierten Aneinanderreihung völlig konträrer Blickwinkel. Der Text, der – wie bereits weiter oben ausgeführt – ohne fixe Sprecher*innenzuschreibungen auskommt, lässt sowohl Rechtspopulist*innen und ‑extremist*innen als auch (islamistische) Terrorist*innen hörbar werden.215 Verfremdend zitiert wird in diesem Zusammenhang der Botenbericht aus Euripides’ Herakles:
Furcht kommt diese Diener an, aber auch Lachen, wir möchten wissen, ob die gelacht haben, nein, sicher nicht, doch es ist überliefert, daß viele lachen, der junge Mann neulich in Graz, keine Ahnung, weshalb, doch er hat Menschen gemäht, dahingemäht mit seinem SUV. Und der hat gelacht. Ist so. Ist verbürgt, von Bürgern, welche verschont blieben.216
Es ist das Lachen der Täter, das hier als Amalgam zwischen antikem Prätext und tagesaktueller Realität fungiert. Das irre Lachen, das sowohl die Wahnsinnstaten des euripideischen Helden begleitet als auch jene des Mannes, der im Sommer 2015 in der Innenstadt von Graz Amok lief und drei Menschen mit seinem Auto tötete.
Im Herausarbeiten dieses Lachens skizziert Jelinek die Genese eines Phänomens, dem der Kulturtheoretiker Klaus Theweleit eine eigene Studie gewidmet hat. Theweleit vergleicht darin das Tötungsverhalten des Rechtsextremisten Anders Breivik mit jenem der Dschihadist*innen, die für die Pariser Terroranschläge 2015 verantwortlich zeichneten, sowie mit den Morden jener Kindersoldaten, die in den Genozid an der Tutsi‐Bevölkerung in Ruanda involviert waren. So unterschiedlich diese jeweiligen Mordtaten auch motiviert sind, so ist ihnen doch allen das gemein, was den Herakles des Euripides so schrecklich grausam erscheinen lässt: ein perfides Lachen, das die »Verkehrung einer ›normalerweise‹ doch Sympathie oder Teilnahme ausdrückenden menschlichen Gesichtsbewegung«217 meint. Tatsächlich, so Theweleit, sei der Vorgang des Lachens phylogenetisch mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Zähnefletschen entstanden:
Aus dem Fletschen, das üblicherweise dem Biss vorausgeht, diesen aber zurücknimmt, sozusagen ausbremst, und in die Lächel‐ oder Lachbewegung überführt, die das Gegenüber nicht tötet, sondern umarmt. Die Gewalt sowie die Möglichkeit, sich ihrer durch das Lachen »zu begeben«, benennt tatsächlich die riesige Spannung dieser »Muskelbewegung«, die tiefe psychische Bewegungen involviert.218
Sowohl Euripides als auch Jelinek nutzen die von Theweleit konstatierte Spannweite dieser mimischen Regung. Das irre Lachen der Täter, das beide in Szene setzen, boykottiert die Grenzziehung zwischen Vernunft und Wahnsinn. Gleichzeitig verunmöglicht es trennscharfe Linien zwischen Komischem und Tragischem. Die Verstörung, die sich dadurch bei den Rezipient*innen einstellt, kann mit der Wirkung verglichen werden, die Jelineks Einsatz der Ironie auslöst. Die Texte der Autorin produzieren immer wieder ein Lachen, das sozusagen im Halse stecken bleibt. In einem Interview mit der Dramaturgin Rita Thiele äußert sich Jelinek dazu wie folgt:
Meine Ironie ist eine wütende, verzweifelte, weil ich ja bei all der Anstrengung des Darstellens weiß, daß es vergeblich ist. Schon Freud weist ja auf die Bitterkeit hin, die im Witz steckt, auf diese Verzweiflung, die aus der Differenz kommt. Die Ironie ist ja eine rein sprachliche Form. Sie kann nicht anders ausgedrückt werden. Daher ist die Ironie ein ideales Mittel fürs Theater, wo der Körper etwas anderes sagen kann als das Sprechen. Ich würde sogar sagen: Gerade wenn es besonders ernst wird, muß man besonders komisch werden.219
Tatsächlich reiht sich Jelinek vor allem mit ihrem Theatertext Wut in eine lange Reihe von Künstler*innen ein, die den Auswüchsen des Terrors seit 9/11 mit Mitteln des Humors begegnen. Die Zeichner*innen von Charlie Hebdoe (denen Jelinek in Wut eine Bühne bietet) sind dafür nur ein Beispiel. Humor, so die Politikwissenschafter*innen Charlotte Heath‐Kelly und Lee Jarvis, stelle eine emotive Bewältigungsstrategie dar, auf die im Kontext mit Terrorismus auffallend häufig zurückgegriffen werde.220 Das Lachen über den Terrorismus diene sowohl einer Zähmung der Angst als auch dazu, den belastenden Emotionen zumindest kurzfristig zu entkommen, wie die Soziologin Giselinde Kuipers konstatiert.221 Wo andere Formen der (künstlerischen) Repräsentation versagen, füllt das Lachen eine bestehende Diskurs‐ und Bedeutungslücke.222
In seiner Abhandlung Die Wahrheit und die juristischen Formen hat Michel Foucault im Rückgriff auf Nietzsches Fröhliche Wissenschaft darauf hingewiesen, dass das Lachen einen wichtigen Anteil am Gewinnen von Erkenntnis hat.223 Als Basis seiner Überlegungen dient Foucault dabei Nietzsches Text »Was heißt erkennen?«, in dem dieser einen Aphorismus Spinozas aufgreift, der einen Gegensatz zwischen intellegere und ridere, lugere sowie detestari herstellt. Wolle man Dinge wahrlich verstehen, so Spinoza in besagtem Aphorismus, müsse man tunlichst vermeiden, sie zu verlachen, zu beklagen oder zu verwünschen. Erst wenn diese Gefühle ausgeschaltet seien, sei es möglich, wahrhaft zu begreifen. Für Nietzsche wiederum stellt sich dieser Schluss Spinozas als völlig untragbar dar, wie uns Foucault zeigt:
Für Nietzsche ist das nicht nur falsch, sondern geradezu das Gegenteil des tatsächlichen Zusammenhangs. Intellegere, begreifen, sei nur ein Wechselspiel oder vielmehr das Ergebnis eines Wechselspiels und eines gewissen Ausgleichs zwischen ridere, verlachen, lugere, beklagen, und detestari, verwünschen.224
Diese drei »Leidenschaften oder Triebe,«225 wie sie Foucault nennt, zielen nicht darauf ab, sich mit dem bestimmten Gegenstand der Erkenntnis zu identifizieren, sondern auf Distanz zu ihm zu gehen. Sich lachend vor ihm zu schützen, ihn beklagend abzutun oder ihn im Verwünschen zu desavouieren – alle »diese Triebe […] zeugen von dem Willen, sich vom Objekt zu entfernen und es zugleich wegzuschieben, um es am Ende sogar zu zerstören. Hinter der Erkenntnis steckt der zweifellos dunkle Wille, das Objekt nicht an sich heranzuholen, sich nicht mit ihm zu identifizieren […].«226 Für Heath‐Kelly und Jarvis bildet diese Foucault’sche Nietzsche‐Lektüre den Ausgangspunkt ihrer These, wonach das Komische in der Konstruktion von Terrorismus als Objekt der Erkenntnis eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. »Through social practices of joking and mockery, a separation is asserted between the subject and object of knowledge production. We laugh at the object of the joke, rendering it intelligible through its entrance into the field of knowledge.«227 Dieses Lachen, so Heath‐Kelly und Jarvis, habe an der Festschreibung von Terrorismus als einer besonderen Form der Bedrohung teil. »This drive to laughter helps constitute terrorism within what Rancière (2004) terms ›the distribution of the sensible‹: the regimes of perception that determine what is seen and unseen, spoken and unspoken – subsequently determining what can be thought, made, and done.«228
Aber ist es tatsächlich ein Lachen über etwas oder jemanden, das Jelineks künstlerische Auseinandersetzungen mit dem Dschihad bzw. mit dem europaweiten Umgang damit provozieren? Eine Spaltung zwischen (lachendem) Subjekt und Objekt (des Witzes) findet dort eben nicht statt. Die Komik innerhalb von Jelineks Texten resultiert vielmehr aus einem appellativen Schreibverfahren, dessen satirischer Modus sich Dagmar von Hoff zufolge nicht darin erschöpfe, »nur eine Rhetorik des Schimpfens und Schmähens zu verfolgen, vielmehr besteht die Haltung und Absicht der satirischen Verfahrensweise darin, Negatives zum Ausdruck zu bringen, also eine ›verkehrte Welt‹ aufzuzeigen, und zwar allein auf der Grundlage einer ›politischen‹ Entrüstung.«229 Die Triebfeder dieser spezifischen komischen Operation ist stets die Wut, wie Jelinek bereits 1993 zu Protokoll gibt:
Meine literarische Technik liegt in der Negativität, in einer satirischen Beugung der Wirklichkeit und im Auf‐die‐Spitze‐Treiben des Wirklichen, und das Wirkliche ist einfach schrecklich, und der Anreiz oder der Impetus meines Schreibens ist einfach Wut und Zorn, das kann ich nicht ändern. Wenn ich nicht Wut empfinde, sehe ich keinen Grund zu schreiben.230
Das Komische innerhalb von Jelineks Texten legt das Missverhältnis innerhalb unserer medialen Konsumtion von Bildern offen und führt es gleichzeitig ad absurdum.231 Das Lachen, das die Autorin dadurch provoziert, bricht stockend hervor, löst mitunter Scham, stets jedoch Irritation aus. Es ist ein Lachen, das sich dem aristotelischen Verständnis, demzufolge das Komische keinesfalls wehtun darf, radikal entzieht.232 Indem Jelinek die Ursprünge und Auswirkungen schmerzvoller Gewalt mit Mitteln des Komischen befragt, widersetzt sie sich diesem Postulat entschieden. Das Komische ist in ihren Theatertexten alles andere als harmlos.
Vor diesem Hintergrund erscheint es mir symptomatisch, dass wir es bei der am häufigsten von Jelinek herangezogenen Tragödie mit den Bakchen zu tun haben, d.h. ausgerechnet mit einer Tragödie, in der Gewalt auf beispiellos schockierende Weise aus‐ und dargestellt wird und in der wir auf geradezu empörende Spielarten des Komischen stoßen.233 Die Tragödie erzählt von Pentheus, der es ablehnt, Dionysos zu huldigen, und der infolgedessen von ihm bestraft wird. Dionysos steckt Pentheus in die Kleider einer weiblichen Mänade und provoziert dadurch, dass dieser von seiner eigenen verblendeten Mutter zerrissen wird. Während der Plot der Tragödie grundsätzlich Anleihe an vielen mythischen bzw. literarischen Vorlagen nimmt, dürfte die Cross‐Dressing‐Szene (Eur. Ba. 912–970) aber eine genuine Erfindung des Euripides sein.234 Interessant ist, dass diese Passage starke Parallelen zu Aristophanes’ Thesmophoriazusen aufweist, wo ein Verwandter des Euripides, Mnesilochos, diesen als Frau verkleidet, um dadurch den für das Thesmophorenfest geplanten Anschlag auf den Dichter zu vereiteln. Craig Jendza hat gezeigt, dass die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Darstellungen nicht nur in der jeweiligen Kleidung bestehen, die darin beschrieben wird, sondern auch in der Haltung der beiden Charaktere in Bezug auf den Akt der Kostümierung.235 Im Gegensatz zu anderen Cross‐Dressing‐Szenen im griechischen Drama liegt der Fokus hier auf den Reaktionen der Maskierten. Es handelt sich dabei um die einzigen erhaltenen Szenen im griechischen Theater, in denen eine männliche Figur gewaltsam in Frauenkleider gehüllt wird und sich dann mit seiner eigenen, neu gefundenen »weiblichen« Erscheinung beschäftigt. Da es keine Belege dafür gibt, dass die Cross‐Dressing‐Szene der Bakchen Teil einer früheren tragischen Tradition ist, hegt Jendza die Vermutung, dass sie der Komödie geschuldet ist.236
Worauf Jendza aber erstaunlicherweise nicht eingeht, ist die Sparagmos‐Szene, d.h. die aus Sicht des Boten geschilderte Zerreißung Pentheus’ durch seine eigene Mutter, zu der es im Zuge des rauschhaften Festes zu Ehren des Dionysos kommt. Diese Szene ist meiner Ansicht nach als genuin parakomisch zu beschreiben. Und zwar nicht, weil sie (wie dies für die Cross‐Dressing‐Szene gilt) eine bestimmte Komödie alludiert. Die Sparagmos‐Szene ist vielmehr von einer spezifischen Uneindeutigkeit geprägt, die zwischen Komischem und Schrecklichem changiert:
Agaue:
Der teure Leib des Sohns – wo ist er, Vater, sprich!
Kadmos:
Was ich mit Mühe aufgespürt – ich bring es hier.
(Winkt den Trägern.)
Agaue:
Ist es ein Ganzes, Glied zu Glied gefügt, wie’s ziemt?
Kadmos:
Zum Ordnen blieb bei all dem Suchen nicht die Zeit.
(Agaue sieht die auf der Bahre liegenden Körperteile.)
Agaue:
O grausam, arg zerstörter – meines Sohnes Leib!
(Verhüllt ihr Haupt.) (Eur. Ba. 1298–1307)
Nun bewirkt die Vorstellung eines Haufens an abgetrennten Gliedern vor allem eines: Sie lässt uns erschaudern. Gleichzeitig aber kann der offensichtlich überforderte Kadmos, der die Zeit dafür verantwortlich macht, die losen Gliedmaße nicht vollständig gezählt und geordnet zu haben, durchaus auch Schmunzeln hervorrufen. Euripides führt das Dionysische also als Kippphänomen vor. Und genau das tut interessanterweise auch Jelinek:
Das Dionysische, das Heiter‐Rauschhafte, die Orgie, ist einerseits Gewalt, die ausgeübt oder erlitten wird, bis zum Zerfetzen der Menschen in der Orgie, andererseits verbinde ich diese Gewalt mit Ironie, also eigentlich mit etwas Komischem, das ja wiederum Zügellosigkeit bedeutet. Aber hinter dem Ungebändigten, Heiteren lauert eben immer dieser archaische Schrei der Gewalt, der auf dem Theater irgendwie sprachlich formalisiert werden, aber gleichzeitig doch immer da sein muß, weil er ja wie ein Orgelpunkt unter die Wirklichkeit gelegt ist, als anhaltender Schrei.237
Exemplifizieren lässt sich dies etwa anhand von Rechnitz (Der Würgeengel), wo Dionysos als zerrissener Gott gleich im ersten Satz von den sprechenden Botinnen und Boten adressiert wird: »Wollen Sie uns sagen, daß Sie einen Menschen gesehen haben, der aus dem Schoß seiner Mutter vom Strahl eines Blitzes herausgelöst worden ist wie ein Knochen aus einem Huhn?«238 Das rauschhafte Fest zugunsten des Dionysos (aus dem sich bekanntlich auch die dionysischen Theaterfestspiele entwickelt haben) fungiert bei Jelinek als Folie für das Massaker im burgenländischen Rechnitz, wo im März 1945 rund 200 jüdisch‐ungarische Zwangsarbeiter getötet wurden, und zwar im Zuge eines von der Gräfin Margit von Batthyány abgehaltenen Schlossfestes.
Das Sprechen des Boten, der in den Bakchen von den unvorstellbaren Gräueltaten der Mänaden Zeugnis ablegt, erscheint in Jelineks Fortschreibung als »totalisiert«, wie wir bei Gerhard Scheit lesen.239 Aufgeteilt auf mehrere »Botinnen und Boten (es kann aber auch nur einer oder eine allein sein, das bleibt der Regie überlassen)« (RE, S. 55) eröffnet es ein beredtes, geschwätziges, stets das Eigentliche aussparendes Schweigen. Das Verdrängte, Geahnte und Spekulierte erscheint dadurch »ins Extreme, Monströse, Orgiastische, Kannibalistische«240 getrieben, so Pia Janke. Darüber hinaus aber fällt dieses Sprechen auch regelmäßig ins Komische. Der in der antiken Tragödie zur Katastrophe führende Sparagmos fungiert in diesem Zusammenhang als tragisch‐komisches Vexierbild:
Da spricht der nackte Mann doch: Mutter, ich bin es, bin dein eignes Kind, das du selbst gebarst! Ich bin doch auch jeder andere, den du ebenfalls gebarst, nein, den du nicht gebarst, entschuldige, ich habe mich geirrt, ich habe dich verwechselt, wenn du die alle geboren hättest, das wäre eine ganze Menge. Und was gar nicht geboren wurde, zumindest nicht von dir, Mutter, das wäre noch viel mehr. Wieso gebärdest du dich dann dermaßen hysterisch? Was soll die Waffe? Weg mit ihr! Die Waffe nieder! Nein, da wird nichts gesagt. Da wird nicht um seine Missetaten der Sohn ermordet, denn er ist zwar ein Sohn, aber nicht der von der Frau Gräfin. Er ist jeder Sohn. Er ist ein Sohn. Aber nicht Ihrer. Was regen Sie sich auf? (RE, S. 113)
Das Komische und/oder (Ver‑)Störende an dieser Passage resultiert aus der darin wirksam werdenden Inkongruenz. Einerseits ruft die Stelle im Rekurs auf die ihren Sohn zerreißende Agaue Assoziationen zu dem grauenvollen Massaker von Rechnitz (und zu der angeblichen Beteiligung der Gräfin Batthyány an den Erschießungen) auf; gleichzeitig spielt sie auf die christliche Dreifaltigkeitslehre an.
Ähnlich verfährt die Autorin im Epilog von Rechnitz, der in Bezug auf seine Struktur, die darin laut werdenden Stimmen und den Schauplatz wesentlich vom Rest des Theatertexts abweicht. Die Botinnen und Boten sind mittlerweile alle abgegangen, als Kulisse dient nicht mehr ein »Schloß in Österreich« (RE, S. 55), sondern eine alpine Jagdhütte, die laut Regievorschlag mit Wildtiergeweih und ausgestopften Vögeln dekoriert ist (vgl. RE, S. 196) und somit das im ersten Teil von Rechnitz im Rekurs auf die Bakchen strapazierte Jagdmotiv ein weiteres Mal aufruft. Wir haben es mit einem Dialog zu tun, der sowohl Sprachfloskeln von NS‑Tätern zitiert als auch Auszüge des Chatprotokolls zwischen dem sogenannten Kannibalen von Rotenburg und seinem freiwilligen Opfer.241 Der reale Kriminalfall wird dabei nicht nur mit dem Massaker von Rechnitz verwoben, sondern vor allem auch mit der christlichen Idee der Eucharistie enggeführt:
Du kannst auch meine Wangen aufbeißen, damit du direkten Zugang zu meinem Mund hast, den du dann weit öffnen kannst. Dann iß bitte meine Zunge komplett bis zur Wurzel! Nimm hin und iß mein Fleisch, dies ist mein Leib, nimm ihn hin und esse! Dies ist mein Blut, nimm es hin und trinke! Ich nehme es ja auch hin. Ich nehme das alles hin. Und es macht mir sicher einen Riesenspaß. (RE, S. 199–200)
Die Komik, die in dieser Passage spürbar wird, ist eine ambivalente. Jelinek entzieht der christlichen Transsubstantiation, d.h. der Wandlung von Brot und Wein in den Leib Christi, »ihre symbolisch‐religiöse Dimension und reduziert sie auf ihren fleischlichen Gehalt.«242 Das dadurch entstehende Gefälle zwischen Erhaben‐Religiösem und Pervers‐Profanem kann Ekel provozieren und/oder Lachen hervorrufen.
Die genannten Beispiele belegen einmal mehr, dass den exzessiv auf bestimmte antike Tragödien Bezug nehmenden Theatertexten Jelineks nicht ausschließlich mit dem Begriff des Tragischen zu begegnen ist. Die für das Theater bestimmten Arbeiten der Autorin mäandern vielmehr zwischen Tragischem und Komischem und produzieren dadurch oftmals ambivalent anmutende, verstörende Affekte. Paradoxerweise sind Jelineks Theatertexte aber gerade in dieser Nicht‐Einordenbarkeit der antiken Tragödie sehr nahe. Wie ich zu demonstrieren versucht habe, zeichnen sich vor allem die späten Tragödien des Euripides durch metatheatrale Kommentare aus, die vermeintlich der Komödie vorbehalten sind. Sie bauen Szenen ein, die durchaus auf das Lachen des Publikums setzen, und lassen dabei die Grenzen zwischen Schrecklichem und Absurdem fließend erscheinen. Affekte der Angst, des Mitleids und der Ergriffenheit mischen sich hier mit Sensationen des Ekels, der Lüsternheit und des Komischen. Tragische Dichter nahmen zudem immer wieder auch Anleihe bei der »niederen« Diktion der Komödie, etwa im Hinblick auf die Sprache der Körperfunktionen oder in Bezug auf ekelerregende Anblicke und Gerüche. Sie taten dies allerdings im Gegensatz zu den Komödiendichtern nicht, um Lachen hervorzurufen, sondern um die Abscheulichkeit des Dargestellten auf erschütternde Weise herauszustellen. Gerade dieser Impetus ist es, der in Jelineks tragisch‐komischen dramaturgischen Verfahren nachlebt.
Endnoten
201 Jendza, Craig Timothy: Euripidean Paracomedy. Diss. Ohio State University 2013, S. 177.
202 Im Gegensatz dazu versteht Sidwell unter paracomedy jene Bauchrednertechnik, die komische Dichter mitunter dazu verwendeten, um andere Komödiendichter zu persiflieren (vgl. Sidwell, Keith: »Poetic Rivalry and the Caricature of Comic Poets: Cratinus’ Pytine and Aristophanes’ Wasps.« In: Griffiths, Alan (Hg.): Stage Directions: Essays in Ancient Drama in Honour of E. W. Handley. BICS Supplement 66. London: Institute of Classical Studies 1995, S. 56–80, hier S. 65).
203 Aischylos etwa entwickelt in der Orestie für die Erinyen eine komisch anmutende Sprache, vgl. dazu Sommerstein, Alan H.: »Comic Elements in Tragic Literature: The Case of Aeschylus’ Oresteia.« In: Willi, Andreas (Hg.): The Language of Greek Comedy. Oxford: Oxford Classical Press 2002, S. 151–168, hier S. 151f. Zur parakomischen Sprache bei Sophokles vgl. Kirkpatrick, Jennet/Dunn, Francis: »Heracles, Cercopes, and Paracomedy.« In: TAPA 132 (2002), S. 29–61, hier S. 39–42.
204 Vgl. zu folgenden Überlegungen auch Felber, Silke: »Im Namen des Vaters. Herakles’ Erbe und Jelineks Wut.« In: Fladischer, Konstanze/Janke, Pia (Hg.): JELINEK [JAHR]BUCH 2016–2017. Wien: Praesens 2017, S. 43–58, hier S. 50–52.
205 Hermann Bahr etwa macht in seinem Dialog vom Tragischen (1904) an dieser Passage die Überzeugung fest, dass Euripides grundsätzlich danach strebe, »die Unsicherheit des Ich« darzustellen: »Der Bote, der schildert, wie sich der Rasende betrug, sagt: Er war nicht mehr derselbe! Dies traf mich furchtbar. Ich hielt im Lesen ein und hatte das Gefühl: über der bloßen Vorstellung, daß es einem geschehen könnte, nicht mehr derselbe, sondern plötzlich ein anderer Mensch zu sein, müsse man eigentlich schon wahnsinnig werden.« (Bahr, Hermann: Dialog vom Tragischen. Berlin: S. Fischer 1904, S. 92–93.)
206 Euripides: »Der Wahnsinn des Herakles. Übers. v. Ernst Buschor.« In: Ders.: Sämtliche Tragödien und Fragmente. Bd. III. Hgg. v. Gustav Adolf Seeck. München: Heimeran 1972, S. 95–190, hier S. 157–59 (922-951), Herv. SF.
207 Reiss, Allan L. et al.: »Anomalous Hypothalamic Responses to Humor in Cataplexy.« In: PLoS one 3/5 (2008), S. e2225-2225; Schwartz, Sophie et al.: »Abnormal Activity in Hypothalamus and Amygdala during Humour Processing in Human Narcolepsy with Cataplexy.« In: Brain 131/2 (2008), S. 514–522.
208 Freud, Sigmund: Gesammelte Werke VI: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 133.
209 Zum tendenziösen Witz bei Freud vgl. auch das Unterkapitel Groteske Körperlichkeit.
210 Ebd., S. 166.
211 Ebd., S. 164.
212 Ebd., S. 167.
213 Buxton, Richard G. A.: »Bafflement in Greek Tragedy.« In: Mètis: Anthropologie des mondes grecs anciens 3/1-2 (1988), S. 41–51, hier S. 51.
214 Papadopoulou, Thalia: Heracles and Euripidean Tragedy. Cambridge: Cambridge University Press 2005, S. 24.
215 Vgl. das Kapitel Vibrant Matter.
216 Jelinek, Elfriede: Wut (kleines Epos. Geh bitte Elfi, hast dus nicht etwas kleiner?). Unveröffentlichtes Bühnenmanuskript. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2016, S. 54.
217 Theweleit, Klaus: Das Lachen der Täter: Breivik u.a. Psychogramm der Tötungslust. Salzburg: Residenz Verlag 2015, S. 233.
218 Ebd., S. 134–135.
219 Thiele, Rita: »Glücklich ist, wer vergisst? Eine E‑Mail‐Korrespondenz zwischen Elfriede Jelinek und Rita Thiele«.
220 Vgl. Heath‐Kelly, Charlotte/Jarvis, Lee: »Affecting Terrorism. Laughter, Lamentation and Detestation as Drives to Terrorism Knowledge.« In: International Political Sociology 11 (2017), S. 239–256.
221 Vgl. Kuipers, Giselinde: »›Where Was King Kong When We Needed Him?‹ Public Discourse, Digital Desaster Jokes and the Function of Laughter after 9/11.« In: Journal of American Culture 28/1 (2005), S. 70–84, hier S. 71.
222 Vgl. hierzu auch Holland, Jack: »From September 11th, 2001, to 9/11: From Void to Crisis.« In: International Political Sociology 3/3 (2009), S. 275–292 und Solomon, Ty: »›I Wasn’t Angry, Because I Couldn’t Believe It Was Happening.‹ Affect and Discourse in Response to 9/11.« In: Review of International Studies 38/4 (2012), S. 907–928.
223 Vgl. Foucault, Michel: Die Wahrheit und die juristischen Formen. Übers. v. Michael Bischoff. Mit einem Nachwort v. Martin Saar. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2015, S. 22f.
224 Ebd., S. 22.
225 Ebd., S. 22.
226 Ebd., S. 22–23.
227 Heath‐Kelly, Charlotte/Jarvis, Lee: »Affecting Terrorism«, S. 244.
228 Ebd. S. 244.
229 von Hoff, Dagmar: »Die Satirikerin Elfriede Jelinek.« https://fpjelinek.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/proj_ejfz/PDF-Downloads/Komik_-_von_Hoff-Beitrag.pdf [Zugriff am 16.12.2020].
230 Elfriede Jelinek in Berka, Sigrid: »Ein Gespräch mit Elfriede Jelinek.« In: Modern Austrian Literature 26 (1993), S. 127–155, hier S. 129.
231 Vgl. Christian Schenkermayr in Costa, Béatrice/Schenkermayr, Christian: »›… ein Lachen, das mit der Erkenntnis der eigenen Ohnmacht einhergeht.‹«https://fpjelinek.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/proj_ejfz/PDF-Downloads/Komik_Costa_Mailwechsel.pdf [Zugriff am 16.12.2020].
232 »Das Lächerliche ist […] ein mit Häßlichkeit verbundener Fehler, der indes keinen Schmerz und kein Verderben verursacht, wie ja auch die lächerliche Maske häßlich und verzerrt ist, jedoch ohne den Ausdruck von Schmerz.« Aristoteles: Poetik., S. 17, 1449b.
233 Die Texte, in denen sich Jelinek (bislang) explizit auf Euripides’ Bakchen gestützt hat, sind Rechnitz (Der Würgeengel), Die Straße. Die Stadt. Der Überfall., Das Licht im Kasten (Straße? Stadt? Nicht mit mir!), Schnee Weiß und Schwarzwasser.
234 Vgl. March, Jennifer: »Euripides Bakchai: A Reconsideration in the Light of Vase‐Paintings.« In: BICS 36 (1989), S. 33–65; Sommerstein, Alan H.: »Baccha and Earlier Tragedy.« In: Stuttard, David (Hg.): Looking at Bacchae. New York: Bloomsbury 2016, S. 29–42, hier S. 39; Jendza, Craig: Paracomedy: Appropriations of Comedy in Greek Tragedy. Oxford/New York: Oxford University Press 2020, S. 109.
235 Vgl. Jendza, Craig: Paracomedy, S. 109ff.
236 Vgl. ebd., S. 110.
237 Thiele, Rita: »Glücklich ist, wer vergisst? Eine E‑Mail‐Korrespondenz zwischen Elfriede Jelinek und Rita Thiele«.
238 Jelinek, Elfriede: »Rechnitz (Der Würgeengel).« In: Dies.: Drei Theaterstücke: Die Kontrakte des Kaufmanns. Rechnitz (Der Würgeengel). Über Tiere. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2009, S. 53–203, hier S. 56, im Folgenden zitiert mit der Sigle RE.
239 Scheit, Gerhard: »Stecken, Stab und Stangl; Rechnitz (Der Würgeengel).« In: Janke, Pia (Hg.): Jelinek Handbuch, S. 156–162, hier S. 159.
240 Janke, Pia: »›Herrschsucht? Ja, haben wir!‹ Die Täter in Elfriede Jelineks Rechnitz (Der Würgeengel).« In: Janke, Pia/Kovacs, Teresa/Schenkermayr, Christian (Hg.): »Die endlose Unschuldigkeit.« Elfriede Jelineks »Rechnitz (Der Würgeengel).« Wien: Praesens 2010, S. 239–277, hier S. 243.
241 Teresa Kovacs informiert uns darüber wie folgt: »Als ›Kannibale von Rotenburg‹ wurde Armin Meiwes, ein Computertechniker aus Rotenburg, bekannt. Er begann mit Hilfe des Internets 1999 mit der Suche nach einem Opfer, das sich freiwillig von ihm schlachten und verspeisen ließe. Er knüpfte dabei zahlreiche Kontakte und tauschte seine perversen Fantasien mit möglichen Opfern aus. Im Jahr 2001 lernte er über das Internet Bernd Brandes kennen, dessen Wunsch es war, bei lebendigem Leib zerrissen und verspeist zu werden. Armin Meiwes und Bernd Brandes tauschten via Chat ihre Schlachtfantasien aus, die von Armin Meiwes abgespeichert, ausgedruckt und dokumentiert wurden. Ein Auszug aus diesen Chatprotokollen wurde im Buch Interview mit einem Kannibalen abgedruckt. Dieses Chatprotokoll dient Elfriede Jelinek als Vorlage für ihren Kannibalen‐Dialog.« (Kovacs, Teresa: »›Nimm hin und iß mein Fleisch.‹ Zum Kannibalismusmotiv im Epilog von Elfriede Jelineks Rechnitz (Der Würgeengel).« In: Janke, Pia/Kovacs, Teresa/Schenkermayr, Christian (Hg.): »Die endlose Unschuldigkeit«, S. 289–311, hier S. 304.)
242 Kovacs, Teresa: »›Nimm hin und iß mein Fleisch‹«, S. 298.