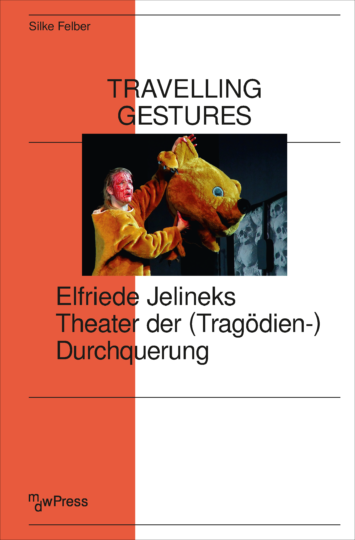Zitieren
Zitieren
Das Konzept der Thing‐Power birgt verlockende Möglichkeiten. Es gestatte uns, so Bennett, das eigentümliche Gefühl aus der Kindheit aufzurufen, wonach die Welt voll von allen möglichen belebten Wesen ist. Und darin steckt durchaus politisches Potenzial. Indem es die Aufmerksamkeit auf eine Wirkkraft von Objekten lenkt, die über die menschlichen Be‑Deutungen hinausgeht, skizziert Thing‐Power ein Denken, das die unter Erwachsenen als unhinterfragbar geltende Binarität von Leben und Materie überschreitet. Auch Materie agiere, so Bennett. Doch tue sie dies niemals alleine: »Its efficacy or agency always depends on the collaboration, cooperation, or interactive interference of many bodies and forces.«32 Es gelte, die Gleichzeitigkeit wechselseitiger Abhängigkeiten zu erkennen bzw. anzuerkennen. Nichtmenschliche Dinge als Akteur*innen und umgekehrt Menschen als belebte Materialitäten zu begreifen, könne unser Konzept von Agency nachhaltig bereichern, so Bennett.
Für die Entwicklung ihrer Theorie einer verteilten Handlungsmacht rekurriert Bennett auf den Stromausfall, der am 14. August 2003 große Teile der USA und Kanadas für Stunden lahmgelegt hatte und von dem 50 Millionen Menschen betroffen waren. Der seit Jahren prognostizierte Ausfall resultierte aus der mangelhaften Wartung völlig veralteter Netze, die die ständig steigende Last nicht mehr verkraften konnten. Bennett liest das Stromnetz als Paradebeispiel dessen, was sie mit Deleuze und Guattari als assemblage bezeichnet, nämlich eine lebendige, pulsierende Ansammlung von geladenen Teilen, die sich gruppieren, um ausgeprägte Effekte zu erzeugen. Die Elemente dieses Gefüges schließen sowohl Menschen und ihre Motive und Konstruktionen mit ein als auch nichtmenschliche Aktanten wie Elektronen, Wind, Kohle, Feuer, Wasser, Bäume und elektromagnetische Felder.
To the vital materialist, the electrical grid is better understood as a volatile mix of coal, sweat, electromagnetic fields, computer programs, electron streams, profit motives, heat, lifestyles, nuclear fuel, plastic, fantasies of mastery, static, legislation, water, economic theory, wire and wood – to name just some of the actants.33
Der Stromausfall schließlich offenbarte sich als letzte Konsequenz einer Kaskade aus höchst unterschiedlichen Begebenheiten, Entscheidungen und Unterlassungen, die zur Überlastung von einzelnen Leitungen und schlussendlich zu einer Spirale von Abschaltungen geführt hatten. Ein Kraftwerk nach dem anderen trennte sich vom Netz und belastete die (noch) verbleibenden Teilnehmer dadurch mehr und mehr. Konkret ergab sich die Kettenreaktion aus einem Zusammenwirken spezifischer Aktanten, nämlich von Elektrizität, Kraftwerken, Übertragungsleitungen, einem Buschbrand, Energiehandelskonzernen, (Strom‑)Nutzer*innen und der Federal Energy Regulatory Commission, deren Energiegesetz aus dem Jahr 1992 die Deregulierung des Stromnetzes vorgenommen und die Privatisierung des Energiemarkts vorangetrieben hatte. Ausgehend von diesen Beobachtungen stellt sich Bennett die folgende Frage: »What difference would it make to the course of energy policy were electricity to be figured not simply as a resource, commodity, or instrumentality but also and more radically as an ›actant‹?«34
Einer Kettenreaktion, an der sowohl menschliche wie auch nichtmenschliche Aktanten beteiligt waren, unterlag auch der verheerende Reaktorunfall von Fukushima, dem Elfriede Jelinek ihren Theatertext Kein Licht. gewidmet hat.35 Die Katastrophe begann am 11. März um 14.46 Uhr Ortszeit, als vor der Ostküste der japanischen Hauptinsel Honshū ein Erdbeben einsetzte.36 Binnen weniger Sekunden erreichten die ersten Wellen des Bebens das Kernkraftwerk Fukushima I und stimulierten dort Seismometer, die die Abschaltung der Reaktoren 1 bis 3 bewirkten. Gleichzeitig beschädigte das Beben die Schaltanlagen des Kraftwerks, wodurch die externe Stromversorgung ausfiel und zwölf Notstromdieselgeneratoren übernahmen. Zudem schalteten alle sechs Reaktorblöcke auf Notkühlung um. Kurz darauf prallten Tsunamiwellen mit der Höhe eines mehrstöckigen Hauses auf das Kraftwerk. Laut der Internationalen Atomenergie‐Organisation (IAEA) war Fukushima I nicht an das vorhandene Tsunami‐Warnsystem angeschlossen, was verheerende Auswirkungen hatte:
The operators were not fully prepared for the multi‐unit loss of power and the loss of cooling caused by the tsunami. Although TEPCO had developed severe accident management guidelines, they did not cover this unlikely combination of events. Operators had therefore not received appropriate training and had not taken part in relevant severe accident exercises, and the equipment available to them was not adequate in the degraded plant conditions.37
Im Zuge der Katastrophe drang das Meerwasser in verschiedene Gebäude vor und flutete mehrere Notstromaggregate, Stromverteilerschränke und letztlich auch die Reaktorblöcke 1 bis 4. Durch den nachfolgenden Ausfall der Stromversorgung war die Kühlung der Reaktorkerne nicht mehr gewährleistet. Zusätzlich herangeschaffte Generatorfahrzeuge wurden u.a. wegen Verkehrsstaus, versperrter Zufahrtswege und zu kurzer Kabel zu spät aktiv, um die Unfallserie zu stoppen. Aufgrund der mangelnden Kühlung kam es zur Überhitzung von Reaktoren und Abklingbecken und in weiterer Folge zu Kernschmelzen in den Reaktoren 1 bis 3. Radioaktivität gelangte durch gezielte Druckentlastung in die Umwelt und verteilte sich mithilfe wechselnder Winde in unterschiedliche Himmelsrichtungen. Zudem kam es zwischen 12. und 15. März zu mehreren Bränden und zu Explosionen, durch die radioaktiver Schutt auf das Kraftwerksgelände geschleudert wurde und die dazu führten, dass stark kontaminiertes Wasser aus einem der Reaktorblöcke austrat. Die Strahlenbelastung auf dem Gelände stieg dadurch stark an. Am 14. März erwog TEPCO, alle Mitarbeiter*innen wegen der zu großen Strahlungsrisiken abzuziehen, erhielt aber keine Erlaubnis des Premierministers.38 50 Mitarbeiter *innen– in den Medien auch als »Fukushima 50« bezeichnet – blieben vor Ort und kümmerten sich weiterhin um die notdürftige Rettung des Kraftwerks. Sie wurden einige Tage später von 140 Helfenden der Feuerwehr Tokios unterstützt, die angeblich von Japans Wirtschaftsminister zu diesem Einsatz gezwungen worden waren.39
Die Nuklearkatastrophe inspirierte Elfriede Jelinek zu der von Intendantin und Regisseurin Karin Beier in Auftrag gegebenen Arbeit Kein Licht., die im Rahmen von Demokratie in Abendstunden am Eröffnungsabend der Spielsaison 2011/12 am Schauspiel Köln zur Uraufführung gelangte.40 Der Text zeichnet eine apokalyptische, durch ökologische und menschengemachte Desaster vernichtete Welt, die im Zerfall begriffen ist. Und doch überlebt aus diesem totalen Zerfall etwas, das jenseits des Humanen und des Materiellen verortet werden kann – nämlich die Sprache. Licht und Klang erscheinen darin als substanzlose Worte, aber auch als agierende Substanzen; sie firmieren gleichzeitig als Metaphern und lebhafte Materie. Tatsächlich haben wir es in Kein Licht. mit einer Sprache zu tun, die, ähnlich wie dies für die Materie Licht, aber auch für Radioaktivität gilt, gerade in ihrer Zerstreuung und Dissemination bestehen bleibt.
Kein Licht. stellt sich nicht als durchgängige Textfläche dar, sondern ist auf zwei nicht näher beschriebene Sprechinstanzen A und B aufgeteilt. Die einzige Regieanweisung, die wir gegen Ende des Textes vorfinden, schlägt vor, dass die Sprecher*innen eine bestimmte Passage gemeinsam schreien oder aber sie untereinander aufteilen: »Sie können sich auch überschneiden, so daß man passagenweise nichts mehr versteht« (KL). Interessant nun ist das Selbstverständnis dieser beiden Sprechinstanzen A und B – sie bezeichnen sich als Geigen:
A: Also, also, also. Da bin ich nun die erste Geige, und was bringt es mir?
[…]
B: Ich bin ja nur die zweite Geige, aber die kann gar nichts machen […].« (KL)
Indem Jelinek den Text an zwei Streichinstrumente bindet, unterwandert sie ein Denken, das Materie als etwas Lebloses, Totes begreift. Sie unterminiert dadurch eine Auffassung, die – wie wir bei Bennett lesen – zentral an der menschlichen Ausbeutung von Flora und Fauna beteiligt ist. Bennett ist überzeugt davon, dass die Vorstellung von toter Materie unsere Fantasien von Eroberung und Konsumtion wesentlich nährt.41 Und sie hält fest: »It does so by preventing us from detecting (seeing, hearing, smelling, tasting, feeling) a fuller range of the nonhuman powers circulating around and within human bodies.«42
In Kein Licht. sind es tatsächlich die von Bennett ins Spiel gebrachten Verben hören, sehen und riechen, um die der Text beständig kreist. A und B sind eben nicht in der Lage, das, worüber sie sprechen, sensorisch zu erfassen. Kein Licht. setzt mit dem Sprechen der ersten Geige ein, die sich darüber beklagt, nichts zu hören außer sich selbst: »He, ich hör deine Stimme kaum, kannst du da nicht was machen? Kannst du sie nicht lauter tönen lassen? Ich möchte mich selbst nicht hören, du mußt mich irgendwie übertönen« (KL). Und später: »Ich wittere mit der Nase in der Luft. Nichts zu riechen, nichts zu hören, nichts. Aber da ist etwas. Da muß etwas sein« (KL). Jelinek lässt also zwei Sprechende vor unseren Augen erscheinen, die sich auf der fieberhaften Suche nach etwas befinden, das weder greifbar noch absehbar ist. Diese Suche inszeniert die Autorin im Rückbezug auf Sophokles’ Die Satyrn als Spürhunde, auf die sie sich auch in ihrem bereits besprochenen Theatertext Schnee Weiß stützt.43 Zur Erinnerung: Ausgangspunkt dieses fragmentarisch erhaltenen Satyrspiels ist der an Apollon verübte Rinderdiebstahl des kleinen Hermes.44 Papposilenos, der Vater der Satyrn, bietet Apollon unter der Voraussetzung eines Finderlohns und der Freilassung aus der Sklaverei seine Hilfe an und hält die eigenen Kinder an, die Witterung der gesuchten Tiere aufzunehmen. Daraufhin der Chorführer:
Chorführer:
Wohlan! Nun soll ein jeder ………….
der mit der Nase wittert …………….
ob in der Luft wo ……………………
zweibeinig hockend ………………….
wittern kann an der Haut ……………
So laßt die Suche und ……………….
alles vortrefflich und …. zu Ende gehn!
Der Chor teilt sich in zwei Hälften, die spähend und witternd umherkriechen45
Im Gegensatz zu Schnee Weiß, wo diese Spurensuche als Vorlage für die Befragung der Verschleierungstaktiken rund um den sexuellen Missbrauch im österreichischen Skisport fungiert, dient Jelinek dieses Sujet in Kein Licht. dazu, die Konsequenzen der atomaren Katastrophe von Fukushima zu verhandeln:
B: Da muß etwas in großer Menge austreten gehen, aber wir merken nicht, wohin es sein Wasser abschlägt. Das Wasser ist allerdings da, kein Zweifel. Oder was das halt ist, das da gekommen ist. Was tritt da aus, um Gottes willen? Es ist etwas, das erst bei sehr hohen Temperaturen verdampft, wie man sagt, es geht aber vorher noch durch uns hindurch und in die Erde und in das Wasser und in die Luft. Was was was? Fußstapfen von unsichtbaren Tieren, von Herden, die über uns hinweggerannt sind? Wie benehmen wir uns denn? Wieso beugen wir uns zu Boden nieder, wenn wir jagen, bleiben gleich liegen? Nicht einmal den Luftzug spürt man, aber man wird ihn noch spüren, da können wir Verlassenen uns drauf verlassen. Will alles dorthin, wohin unsere Töne uns vorausgespurt haben, doch wir treten aus der Spur immer wieder heraus, wozu dann die Spur vor uns überhaupt, wenn wir doch immer wieder seitlich ins Gebüsch plumpsen? Dann müssen wir wieder einsteigen und ihnen nach, ihnen nachspüren, sie zur Melodie notfalls zwingen. Bis wir nichts mehr spüren. Irgendwo müssen die doch sein, die guten Töne! Wenn wir uns nicht hören, hört sie vielleicht jemand andrer, nein, es muß sie jemand andrer hören! Unbedingt! Zweibeinig hockend die Menschen hinter Bäumen, am Abschlag, beim Abschlagen, ihre Nasen wittern in die Luft, schnüffeln nach einander, ob da was ist, was noch genießbar wäre. Doch geruchlos, geschmacklos und wasserdicht wie unsere Kleidung sind wir. Davor und danach. Man merkt keinen Unterschied. Können nicht einmal Rauch von Dampf unterscheiden, das eine schwarz, das andre weiß, doch es macht keinen Unterschied mehr. Sie hören nicht, sie sehen nichts, sie säen nicht, sie sägen nicht, doch sie wissen, da ist was. Da ist was. (KL)
Wer oder was aber begibt sich hier auf Spurensuche? Mit A und B werden zwei Instrumente hörbar, die im Rückgriff auf den antiken Prätext des Satyrspiels implizit das technische Gerät des Geigerzählers aufrufen, d.h. einen Apparat, der die Aufgabe hat, das Unsichtbare, Unriechbare und Unhörbare aufzuspüren. Gleichzeitig wecken die Sprechenden Assoziationen zu den hybriden Mischwesen der Satyrn, die zwischen Mensch und Tier, aber auch zwischen mythologischer Figur und Theaterfigur changieren. Jelineks Sprechinstanzen A und B entpuppen sich mithin als Inbegriff dessen, was Jane Bennett mit dem Terminus der assemblage zu fassen intendiert, nämlich ein sich aus lebhaften Materialitäten unterschiedlicher Art zusammensetzendes Gefüge.
Als ein derartiges Gefüge kann auch die Geige bezeichnet werden, die sich aus heterogenem organischem Material konstituiert. Der Korpus der Violine besteht aus Holz, ihre Saiten wurden lange Zeit aus Darm von Huftieren gewonnen, heute wird dafür meist Stahl verwendet. Zum Klingen gebracht wird das Instrument von einem Bogen aus Rosshaar, der wiederum auf (menschliche) Spieler*innenhände angewiesen ist. Auch in Die Satyrn als Spürhunde kommt einem Saiteninstrument eine wesentliche Bedeutung zu; hier werden die Satyrn vom Klang der ihnen unbekannten Lyra erschreckt. Kyllene, die Amme des lyraspielenden Hermes, bezeichnet das Instrument als totes Tier, das zum Sprechen gebracht wird. Die darauffolgende stichomythische, leider lediglich fragmentarisch erhaltene Rateszene demonstriert das eindrücklich:
Chorführer:
Was ist das Tönende daran? Das Innen oder Außen? Sprich!
Kyllene:
(Ein Teil des Tieres) ist hügelförmig, Muschelschalen nah verwandt.
Chorführer:
Mit welchem Namen nennst du es? Erzähle, wenn du noch was weißt!
Kyllene:
Schildkröte nennt der Bub das Tier, doch Lyra jenen Teil, der tönt.
Chorführer:
Wem (scheint) der Schatz (denn holder) als ……?
Kyllene:
………………. …………… der Rinder Wirbelknochen und die Haut.
…………………………………………. so klingt die Krötenschale nun.
Geschnittene Hölzer, starke Nägel wurden da hineingebohrt.
…………………………… gedrehte Därme ……………………………
…………………………… der Höhlung ……………………………….
…………………………… die Wirbel ………………………………….
…………………………… der Knoten ………………………………….
[…]
darin der Krötenschale rauher Buckel sich erhebt,
und dieses ist im Kummer Heil‐ und Beruhigungsmittel
ihm,
sein einz’ges, außer sich vor Freude, singt ein Lied er, das
damit
zusammenklingt; es reißt ihn hin der Lyra wandelbarer
Klang.
So zauberte der Knabe dem verstorbnen Tiere Wohllaut an.46
Die Passage verlangt nach einer genaueren Betrachtung der Lyra. Im klassischen Zeitalter nämlich, so der Altphilologe George Kovacs, konnte der Begriff jede Art von Zupfinstrument bezeichnen.47 Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Schalen‐ bzw. Muschellyren, deren Resonanzkörper aus einem Schildkrötenpanzer besteht, und Lyren, die hölzerne Resonanzkörper haben. Ist in klassischen Texten von der Lyra die Rede, so ist damit meist die Chelys, also die Schildkrötenleier, gemeint. Ein solches Exemplar ist es auch, auf das sich der Hermes‐Mythos und Sophokles’ Die Satyrn als Spürhunde beziehen. Visuelle Darstellungen und erhaltene Fragmente von Klangkörpern legen nahe, dass für die Herstellung dieses Instruments der Panzer der Breitrandschildkröte verwendet worden ist. Dabei handelt es sich um die größte Schildkrötenart Griechenlands – eine ausgewachsene Schildkröte kann eine Panzerlänge von bis zu 34 Zentimetern erreichen. Gebaut wurde diese Lyra, indem man den Schildkrötenpanzer aushöhlte, Arme und ein Joch für die Saiten anbrachte und den Resonanzkörper mit gespannter Tierhaut überzog. Der Steg saß direkt auf der gespannten Haut. Darstellungen auf Vasen erwecken den Eindruck, dass das Instrument leicht und einfach zu tragen war.
Es handelt sich bei der Lyra also um ein Saiteninstrument, das aus einem (toten) Tier besteht und das erst durch (lebendige) Finger zum Klingen gebracht wird.48 Die zitierte Beschreibung Kyllenes aus Sophokles’ Satyrspiel verbildlicht diesen Assemblage‐Charakter. Die Lyra erscheint darin weniger als »Ding« denn vielmehr als lebendige Materie, als vibrant matter, um mit Bennett zu sprechen. Umso interessanter ist es, dass sich Jelinek gerade an dieser Passage intensiv abarbeitet:
Was an uns könnte noch klingen, da es die Geigen nicht tun? Die Wirbelknochen von Rindern, die niemand mehr essen darf? Die Krötenschalen, die man wird meiden müssen? Die gedrehten Därme unserer Saiten, neben denen unsere Eingeweide bald nichts als Schlamm sein werden? Eine Höhlung voll Müll? Die Wirbel, mit denen wir stimmen, obwohl nichts mehr stimmt? Der Knoten, den uns jemand geknüpft hat? Was? (KL, Herv. SF)
Der intertextuelle Rückgriff auf Kyllenes Beschreibung der Lyra lässt die Grenzen zwischen Humanem und Animalischem und zwischen Belebtem und Unbelebtem verschwimmen. Die Schlüsselbotschaft, die daraus spricht, könnte mit Jane Bennett wie folgt lauten: »Humanity and nonhumanity have always performed an intricate dance with each other. There was never a time when human agency was anything other than an interfolding network of humanity and nonhumanity; today this mingling has become harder to ignore.«49 Tatsächlich treibt Kein Licht. ein Denken voran, das einerseits die Vitalität nichthumaner Körper ernst nimmt und das andererseits vom Menschen den verantwortungsvollen Umgang mit dem von ihm bewohnten Planeten einfordert.
Ähnlich dem von Bennett verhandelten großen Blackout aus dem Jahr 2003 deckte auch die Nuklearkatastrophe von Fukushima viele Unzulänglichkeiten und (menschliche) Fehler auf. Bereits wenige Tage nach dem Erdbeben und dem darauffolgenden Tsunami offenbarte ein Briefwechsel zwischen TEPCO und der japanischen Atomaufsichtsbehörde, dass dem atomaren Desaster Wartungsfehler vorausgegangen waren. Anzusetzen sei aber bereits viel früher, so der Nuklearexperte Arnold Gundersen. Er konstatiert, dass die Ingenieure der amerikanischen Unternehmen General Electric und Electric Bond and Share Company, die das japanische Kraftwerk designten und 1965 erbauten, folgende sechs kritische Fehler gemacht haben:
- The height of the cliff where the plant was located was reduced from thirty‐five meters to ten meters
- The tsunami wall was too short
- The diesel generators were placed in the basement
- The emergency pumps located on the shoreline were not submersible pumps
- The diesel fuel tanks were placed in the floodplain
- The flawed Mark I containment was unable to contain the radiation50
Denkt man Gundersens Bemerkungen weiter, so lässt sich aus ihnen ableiten, dass der Großteil der Katastrophe von Fukushima auf die Unterschätzung der Wirkmächtigkeit eines Tsunamis zurückzuführen ist. »There are 440 nuclear reactors in the world, and none of them have been designed to handle a detonation shock wave – a wave that travels faster then the speed of sound – because engineers dismissed it as impossible.«51 Tatsächlich aber ist das vormals Undenkbare eingetreten. In einem vermeintlich perfiden Zusammenspiel entwickelten Wind, Wasser und Erde 2011 eine immense Agency, die auf die Hybris des Menschen prallte und sich nach einer Verkettung unterschiedlicher Ereignisse, Unterlassungen und Zufälle in einem unvergleichbaren Fiasko entlud.
Kein Licht. rückt dieses menschlich‐nichtmenschliche Zusammenwirken in den Vordergrund, ohne dabei die rhetorische Strategie der Schuldabkehr, von der das Sprechen der Kraftwerkbetreiber sowie der verantwortlichen Politiker*innen geprägt war, auszublenden: »Nein, nicht wir, andere, immer andere! Die anderen können nichts, wir können bloß nichts dafür und wo sind sie überhaupt, diese anderen?« (KL). Der Mensch selbst tritt innerhalb des Theatertexts nicht auf. Hörbar wird vielmehr ein anklagendes Sprechen über die als unberechenbar, wütend und launisch hochstilisierten, mithin anthropomorphisierten Elemente Erde, Wasser und Wind, die als Sündenböcke vorgeführt werden: »Die Natur müßte auch nicht immer so übertrieben reagieren, finde ich, also die ist schon auch selber schuld, das kann ich ihr nicht abnehmen« (KL). Profitgier sowie das scham‐ und rastlose Streben nach Macht emergieren innerhalb von Kein Licht. neben Licht, Strom, Rindern, Tsunami und bebender Erde. Die beiden Geigen A und B, die sich hier Gehör zu verschaffen versuchen, sind durchdrungen von Menschlichem und Nicht(-mehr)‐Menschlichem, von Trauer um die zu Tode Gekommenen und von einem Gemahnen an die Verantwortlichkeit der Lebenden: »Ein Urteil bitte. Ihr Urteil bitte!« (KL), so endet der Text. Was aber bleibt von dem Unglück?
Im Gegensatz zum Super‐GAU von Tschernobyl, der mit der statischen Impression eines Sarkophags in unser visuelles kollektives Gedächtnis eingegangen ist, bringen wir die atomare Katastrophe von Japan mit dynamischen Bildern in Verbindung, die von emsiger Arbeit zeugen, von »measures toward the revitalization of Fukushima,«52 wie es auf der Website des Unternehmens TEPCO heißt. Es erstaunt nicht, dass Jelinek einige der um die Welt gegangenen Fotos von den Dekontaminationsarbeiten in Fukushima wie Zitate in den auf ihrer Website publizierten Theatertext montiert. Ganz anders nämlich als die schwarzen, bleiernen Schürzen der sogenannten Liquidatoren, die sich 1989 in Tschernobyl den tödlichen Dekontaminationsarbeiten gewidmet haben, begünstigen die strahlend weißen Anzüge der »Fukushima 50« das von TEPCO verfolgte Image einer weißen Weste. In einer Presseaussendung des Kraftwerkbetreibers aus dem Jahr 2012 heißt es: »[…] we have continued our efforts in learning as much as possible.«53 Ob Atomriesen wie TEPCO tatsächlich daran interessiert sind, dazuzulernen, lässt Elfriede Jelinek dahingestellt. Ihr Fukushima‐Text zeigt vielmehr, dass ein solches Lernen bedeuten muss, den Menschen ganz im Sinne eines postanthropozentrischen Denkens einerseits als Auslöser größtmöglicher Katastrophen und Krisen anzuerkennen, ihn gleichzeitig aber lediglich als Teil einer viel komplexeren assemblage zu begreifen; als Teil eines aus vielfach be‑lebter Materie bestehenden großen Ganzen.
Endnoten
32 Bennett, Jane: Vibrant Matter. A Political Ecology of Things, S. 21.
33 Ebd., S. 25.
34 Ebd., S. VIII.
35 Vgl. hierzu auch das Kapitel Antigone post Fukushima.
36 Zu den Ereignissen rund um die atomare Katastrophe von Fukushima und ihren Auswirkungen vgl. IAEA: The Fukushima Daiichi Accident. 2015. https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1710-ReportByTheDG-Web.pdf [Zugriff am 20.3.2023].
37 Ebd., S. 6.
38 vgl. IAEA: The Fukushima Daiichi Accident. 2015. https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1710-ReportByTheDG-Web.pdf [Zugriff am 20.3.2023], S. 39.
39 N.N.: »Feuerwehrmänner zum Einsatz in Fukushima gezwungen.« https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2011-03/japan-atomkraft-fukushima 22.3.2011 [Zugriff am 4.1.2016].
40 Jelinek, Elfriede: Kein Licht. https://www.elfriedejelinek.com/fklicht.htm 21.12.2011 [Zugriff am 11.2.2021] (= Elfriede Jelineks Website, Rubrik Zum Theater), im Folgenden zitiert mit der Sigle KL.
41 Vgl. Bennett, Jane: Vibrant Matter. A Political Ecology of Things, S. IX.
42 Ebd., S. IX.
43 Vgl. hierzu das Kapitel Die Bakchen im Skizirkus.
44 Vgl. zu den folgenden Überlegungen Felber, Silke: »Inmitten von Satyrn, Boten und lebenden Toten. Tragische Figurationen der Durchquerung.« In: Felber, Silke/Hippesroither, Wera (Hg.): Spuren des Tragischen im Theater der Gegenwart. Tübingen: Narr 2020, S. 33–44, hier S. 36–38.
45 Sophokles: »Die Satyrn als Spürhunde.« In: Ders.: Dramen. Übers.u. hgg. v. Wilhelm Willige. Düsseldorf: Artemis & Winkler 2007, S. 659–689, hier S. 667 (87–93).
46 Sophokles: »Die Satyrn als Spürhunde«, S. 681–83 (303-320).
47 Vgl. Kovacs, George A.: »Stringed Instruments in Fifth‐Century Drama.« In: Mnemosyne Supplements 353 (2013), S. 477–500, hier S. 478.
48 Vgl. zu dieser Überlegung auch Uhlig, Anna: »Noses in the Orchestra. Bodies, Objects, and Affect in Sophocles’ Ichneutae.« In: Telò, Mario/Mueller, Melissa (Hg.): The Materialities of Greek Tragedy, S. 153–168.
49 Bennett, Jane: Vibrant Matter. A Political Ecology of Things, S. 31.
50 Gundersen, Arnold: »What Did They Know and When?« In: Caldicott, Helen (Hg.): Crisis Without End: The Medical and Ecological Consequences of the Fukushima Nuclear Catastophe, S. 139–146, hier S. 139.
51 Ebd., S. 141.
52 https://www.jaif.or.jp/ja/annual/46th/46-s3_tsunemasa-niitsuma_e.pdf [Zugriff am 11.1.2021].
53 https://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2012/1205638_1870.html 20.6.2012 [Zugriff am 11.1.2021].