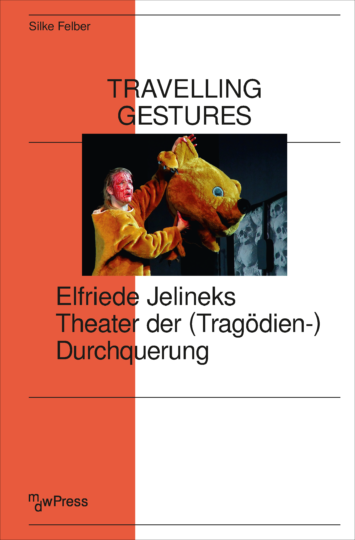Zitieren
Zitieren
Unterkapitel
Unterkapitel
1.1 Reisende Gesten?
6.2.1 (Tages-)Politische Allusionen und ad-personam-Attacken
6.2.2 Chorisches Sprechen zwischen tragoidia und comoidia
6.2.3 Sprachliche Verfahren des Paratragischen
6.2.4 Autoreferenzialität und Metatheatralität
6.2.5 Groteske Körperlichkeit
Die Idee der gegenseitigen Wechselwirkung von Tragödie und Komödie findet sich bereits bei Aristophanes, der in seiner frühen Komödie Die Acharner (425 v. Chr.) den Neologismus trygoidia (Arist. Ach. 499f.) einführt. Das Paradoxale dieses Begriffs kehrt in Kratinus’ großartiger Wortbildung euripidaristophanizon wieder.36 Der Komödiendichter sieht diese für einen Zuseher vor, der sich fragt, wie sich Aristophanes’ Kritik an der euripideischen Tragödie mit der Tatsache vereinbaren lässt, dass der Komödiendichter Elemente aus tragischen Texten auf raffinierte Weise in seine eigenen Stücke integriert. Wie passt die Freude an ausgefeilten Aphorismen zu der scharfen Kritik, die Aristophanes an Euripides und der Tragödie übt? Und wie kommt es, dass man über das Tragische lachen kann? Diese Fragen stellen sich in ähnlicher Dringlichkeit angesichts des intertextuell‐verwebenden Verfahrens von Elfriede Jelinek, dessen komisches Potenzial sich nicht zuletzt aus der Parodie des tragischen Genres ergibt.
Die kritische Auseinandersetzung der Komödie mit der Tragödie verweist auf eine lange Traditionslinie. Sie ist bereits in Texten auszumachen, die zu einer Zeit entstanden, da die komoidia noch nicht als eigene Kunstform am dionysischen Agon partizipierte. So wissen wir etwa von einem Anfang des 5. Jahrhunderts entstandenen, aus der Feder des in Sizilien tätigen Dinolochus stammenden Text namens Komoidotragoidia. Möglicherweise inspirierte dieser Titel die beiden attischen Komödiendichter Alcaeus und Anaxandrides (tätig zu Beginn des 4. Jahrhunderts) – beide verfassten eine sogenannte Komoidotragoidia. Als intensiv stellt sich die komische Auseinandersetzung mit dem Tragischen im Athen des ausgehenden 5. Jahrhunderts dar. Wenngleich die einzigen vollständig erhaltenen Komödien, die uns aus diesem Zeitraum vorliegen, von Aristophanes stammen, so lässt die Zusammenschau dieser Texte mit Fragmenten anderer zeitgenössischer Komödienautoren wie Cratinus, Eupolis oder Strattis den Schluss zu, dass die Tragödie grundsätzlich einen beliebten Referenzpunkt innerhalb der Alten Komödie darstellte.37 Das komische Genre lässt es zu, Sprache und Gestus des Tragischen zu persiflieren, auf bestimmte Tragödien anzuspielen bzw. einzelne Szenen daraus zu parodieren oder aber auch Scherze auf Kosten bestimmter Tragödiendichter zu machen. Aristophanes etwa liebte es, die großen Tragiker namentlich in seinen Komödien auftreten zu lassen – allen voran Euripides, der in drei seiner Werke in Erscheinung tritt.
Erstmals wandte Aristophanes diesen dramaturgischen Kunstgriff in den Acharnern an, d.h. in einer Komödie, die sich explizit auf die 438 zur Uraufführung gelangte euripideische Tragödie Telephos bezieht. Der Protagonist Dikaiopolis, mit dem sich die Dichter‐Instanz Aristophanes in einer bestimmten Passage auch identifiziert (vgl. Arist. Ach. 377–82), übernimmt hier das Auftreten und die Wortgewaltigkeit des euripideischen Helden, um die Köhler von Acharnai von seinen eigenen Interessen zu überzeugen. Doch bevor Dikaiopolis seine Rede hält, begibt er sich in das Haus des Euripides und bittet diesen, ihn mit dem tragischen Kostüm aus der eigentlichen Produktion von Telephos auszustatten. Euripides willigt zunächst ein. Als Dikaiopolis aber daraufhin ein Requisit nach dem anderen verlangt, ruft er entrüstet: »Der wird mir noch meine tragische Dichtkunst rauben!« (Arist. Ach. 464). Bernhard Zimmermann bringt den kritisch‐parodistischen Subtext dieser Passage auf eine einfache Formel, wenn er behauptet, dass »die Wirkung der euripideischen Tragödien […], wie der Meister selbst zugibt, nicht auf der Konzeption seiner Stücke, sondern in erster Linie auf der Ausstattung, auf Kostümen und Requisiten [basiert].«38 So gesehen entspreche Aristophanes ganz dem, was Aristoteles in der Poetik hervorhebt, wo es heiße, »daß sich Kraft und Wirkung (δύναμις) einer Tragödie, vor allem ihr Telos, Furcht und Mitleid zu erregen, auch ohne die Mittel einer Inszenierung und ohne Schauspieler entfalten müssen«.39
Bei aller Kritik an der Tragödie und ihren Dichtern, die man aus Aristophanes’ Komödien herauslesen kann, lassen sich die in diesen Texten zur Anwendung gelangenden paratragischen Verfahren aber auch als wertschätzende Gesten in Richtung des »ernsten« Genres verstehen. Exemplarisch zeigt sich dies anhand von Aristophanes’ Komödie Die Thesmophoriazusen (Frauen am Thesmophorenfest), in der sich die titelgebenden Frauen für die Rufschädigung rächen wollen, die Euripides ihnen in all seinen Tragödien beschere. Wie Helene Foley hervorgehoben hat, dient die Tragödie hier zwar immer noch dazu, die Redefreiheit der Komödie zu stärken, »[b]ut it also implicates comedy and tragedy in a far deeper shared competitive game: tragic, satiric, and comic plots already shared in deploying deception, intrigue, disguise, and escape.«40 Das integrative Verfahren, das in Aristophanes’ Tragödienaneignungen zum Einsatz gelangt, kann mit Helene Foley als ein Versuch gelesen werden, durch die produktive Aneignung des Tragischen das politische Potenzial des Komischen hervorzuheben. Dieser Impetus spiegelt sich in Elfriede Jelineks Fortschreibungen der griechischen Tragödie auf erstaunliche Art wider. Tatsächlich besteht die ästhetische Strategie, die diese Texte durchzieht, darin, Pathos im Zitieren und Modulieren der tragischen Dichter zu evozieren und dieses im selben Atemzug durch die prozessuale Schichtung mit Bruchstücken des Alltäglich‐Profanen wieder zu brechen.41
Ein eindrückliches Beispiel liefert etwa der Theatertext Die Kontrakte des Kaufmanns. Eine Wirtschaftskomödie (2008), den Jelinek anlässlich der Skandale rund um die österreichische Meinl‐Bank und die ehemalige Gewerkschaftsbank BAWAG verfasste und der die Auswüchse der Finanz‐ und Wirtschaftskrise in beinahe prophetischer Weise vorwegnehmen sollte. Wir haben es dabei mit einem Text zu tun, der auf mehreren Ebenen an die griechisch‐antike Tragödie anschließt. Zum einen verarbeitet er die euripideische Herakles‐Tragödie intertextuell (»Danke, Helene Schuberth, danke, Europa, äh, Euripides (›Herakles‹, nach der Übersetzung von J. J. Donner)«42). Zum anderen greift er Bauelemente dieses Genres, wie etwa den Prolog oder – in Form eines Zusatztexts – den Epilog auf: Nach der Uraufführung durch Nicolas Stemann verfasste Jelinek auf Anregung des Regisseurs ein Addendum, das sich u.a. auf die Elektra des Euripides bezieht. Dieser Epilog wurde von Stemann in die Inszenierung integriert und war von da an Bestandteil der Folgeaufführungen.43 Als zentral offenbart sich zudem Jelineks Rückgriff auf den Chor, namentlich auf den Chor der Greise, dem in Euripides’ Herakles eine hauptsächlich kommentierende Funktion zukommt. Dieser Chor beklagt zunächst das Schicksal von Herakles’ Frau Megara und deren Kindern, die dem Tyrann Lykos zum Opfer fallen sollen. Später jubelt er über die siegreiche Rückkehr Herakles’ und ergeht sich schlussendlich ein weiteres Mal in Klage, sobald Herakles – von Lyssa, der Göttin des Wahns, befallen – seine eigenen Kinder tötet. Jelinek extrahiert diesen (tragischen) Chor der Greise aus der euripideischen Tragödie und stellt ihm einen Chor der Kleinanleger gegenüber, der auf die zahlreichen Verlierer*innen der Finanz‐ und Wirtschaftskrise von 2008 bzw. 2009 verweist.
Trotz des expliziten und impliziten Rückgriffs auf das Tragische bezeichnet Jelinek ihren Text als Wirtschaftskomödie. Von diesem Untertitel scheinbar irritiert, fragte Stemanns Dramaturg Joachim Lux die Autorin anlässlich der Uraufführung des Textes danach, was denn so »komisch« an den soziopolitischen Auswüchsen einer Krise sei. Und Jelinek antwortete darauf wie folgt:
Die Dialektik zwischen dem Offensichtlichen und dessen Verdrängung und Verleugnung, insbesondere der Beglaubigung eines Wertpapiers durch einen berühmten Namen, unter den man dann seinen eigenen, viel kleineren Namen setzen darf, und damit hat man dann Papiere als mündelsicher und mit Profitgarantie erworben, die nichts als impotente Zertifikate sind, die man als solche nicht, wie es sich in diesen Kreisen eigentlich gehören würde, mit ihrem richtigen Namen vorgestellt bekommen hat. Man setzt seinen unwichtigen Namen also, im Namen eines Namens, mit dem man sich gern identifizieren würde, unter das, was einem Gewinn garantiert, aber den totalen Verlust bringt. Das kann bei aller persönlicher Tragik schon auch sehr komisch sein. Andererseits aber eben in eine echte Tragödie münden (alle guten Komödien sind nur haarscharf von der Tragödie entfernt), in Mord, Selbstmord, Verzweiflung.44
Ähnliches entnehmen wir einem Interview, das die Dramaturgin Rita Thiele anlässlich von Karin Beiers Abend Das Werk/Im Bus/Ein Sturz (2010) am Schauspiel Köln geführt hat und in dem Jelinek anmerkt: »Die Lächerlichkeit, eben das Parodistische, entsteht aus der Fallhöhe zu den großen Texten, die ich natürlich verstärke oder überhaupt erst herstelle.«45 Vor diesem Hintergrund erscheint es tatsächlich verwunderlich, dass Jelineks Theatertexte bislang noch nicht im Kontext der Alten Komödie gelesen worden sind.
Ich möchte im Folgenden zeigen, dass Jelineks Rückgriff auf das Tragische – ebenso wie jener des Aristophanes – ein zweifacher ist. Einerseits untersuchen die beiden Dichter*innen die Tragödie aus politischer Sicht und befragen ihre didaktische Funktion innerhalb der Gemeinschaft. Andererseits blicken sie aus einer poetologischen Perspektive auf dieses Genre. Im Hinblick auf Jelineks spielerische Dekonstruktion tragischer Prätexte möchte ich vorschlagen, die damit in Zusammenhang stehende schichtende Ästhetik als paratragisch zu beschreiben.46 Ausgehend von diesen Überlegungen werde ich die Alte Komödie – und hier vorrangig die Texte des Aristophanes – auf spezifische Techniken des Komischen hin untersuchen und gleichzeitig demonstrieren, inwiefern Jelinek diese Verfahren in ihren Tragödienfortschreibungen recycelt. Die Analyse berücksichtigt sowohl stilistische und sprachliche Merkmale wie auch schauspielästhetische Parameter und Phänomene der Metatheatralität.
6.2.1 (Tages‑)Politische Allusionen und ad‑personam‐Attacken
Worin wurzelt die immense Faszination für die Komödien des Aristophanes? Was ist es, das diese Texte so erfolgreich bei ihrem Publikum machte und dem Dichter einen Sieg nach dem anderen einbrachte? Möglicherweise lassen sich diese Fragen mit einem Blick auf die überaus spezielle Wirklichkeitskonzeption beantworten, die allen Texten des Aristophanes zugrunde liegt. Im Gegensatz zur Tragödie, die sich hauptsächlich am Mythos orientiert, ist die Alte Komödie an virulenten Themen und Fragestellungen hinsichtlich der attischen Gesellschaft interessiert und beleuchtet diese quasi unter real‐time‐Bedingungen.47 Das eigene Genre stets in metatheatraler Manier mitreflektierend, prangert sie Politiker, Denker und Dichter offen an und hält diesen oftmals im Publikum anwesenden Schlüsselfiguren des öffentlichen Lebens den Spiegel vor. Aristophanes setzt mit seinen Arbeiten grundsätzlich an den soziopolitischen Problemen Athens an. Selbst in Komödien wie Die Vögel oder Die Frösche, in denen der Plot nicht in Athen angesiedelt ist, bleibt die Stadt im Hintergrund präsent. Zu behaupten, dass Aristophanes innerhalb seines Werkes ein getreues Abbild der Wirklichkeit zeichne, ginge jedoch zu weit. Der Dichter schildert vielmehr das tatsächliche Leben auf groteske und ungewöhnliche Weise, sodass die fantastische Welt der Komödie, verkörpert durch den Protagonisten und den Chor, ständig mit dem Athener Alltag kollidiert. Daraus ergibt sich eine durchaus vielschichtige Realität, wie Bernhard Zimmermann bemerkt:
The result is a multilayered reality that, like a palimpsest, contains the past within itself, not in any abstract fashion but, as befits the technique of comedy, embodied in a chorus of the founders of democracy (Lysistrata), the men who fought at Marathon and Salamis (Acharnians, Wasps, Lysistrata), or representatives of the good old days like the rejuvenated Demos in Knights or Aeschylus in Frogs.48
Der Terminus des Palimpsests, den Zimmermann hier verwendet, taugt nicht nur hervorragend für die Beschreibung der Weltentwürfe des Aristophanes, sondern eignet sich auch wunderbar für die Analyse der Theatertexte Elfriede Jelineks. Die Autorin unterstreicht die Vielschichtigkeit der Welt grundsätzlich mit Nachdruck und erhebt sie gleichzeitig zur Maxime des eigenen Schreibverfahrens.49 Ulrike Haß hat für den Begriff des Palimpsests hervorgehoben, dass dieser »sowohl für das Überprägen alter Strukturen als auch für das Durchprägen vormaliger Strukturen in einer Gegenwart«50 gilt. Die Oberflächen, die durch diese Prozedur zutage treten, entsagen trennscharfen Grenzen und boykottieren ein simples Entweder‐oder. »Diese Oberflächen trennen keine Vergangenheit von einer Gegenwart ab, kein Außen vom Innen, kein Vormaliges vom Hier und Jetzt. Der Begriff des Palimpsests sagt uns, dass es sich bei Oberflächen um Übergangszonen handelt, um mehrbödige und ausgedehnte Objekte, die summarisch und in einer anderen Sprache auch res extensa genannt wurden.«51
In Jelineks Tragödienfortschreibungen schichten sich Prätexte über Prätexte, ohne sich voneinander abzuheben. Der Umstand, dass die »recycelten« Zitate nicht explizit ausgewiesen werden, lässt ein scheinbar homogenes, multilagiges Textgebilde entstehen. Innerhalb dieses Gebildes fungieren die kanonisierten Werke der sogenannten alten Meister als »Rhythmusgeber«, wie die Autorin selbst sagt. »Ich hangle mich an ihnen [den alten Texten, Anm. SF] entlang, um dann immer wieder (hoffentlich) neue Räume aufzuschließen, mit ihren Schlüsseln.«52 Die Tragödien des Aischylos, des Sophokles oder des Euripides geben die Folie ab, vor der Jelinek – ähnlich wie Aristophanes – aktuelle zeitgenössische Themen mit Mitteln des Komischen verhandelt. Bei Jelinek sind dies etwa, um drei willkürliche Beispiele zu nennen, die europäische Migrations‐ und Asylkrise (Die Schutzbefohlenen), der NSU‐Prozess am Oberlandesgericht München (Das schweigende Mädchen) oder die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in der outgesourcten Textilindustrie (Das Licht im Kasten). Der diesen Arbeiten zugrunde liegende Schichtungsprozess lässt nicht nur das sogenannte Tragische auf das Komische stoßen. Er lässt auch Vergangenheit und Gegenwart schockartig aufeinanderprallen. So gibt Jelinek in Bezug auf den Entstehungsprozess ihrer Agamemnon‐Fortschreibung Ein Sturz Folgendes zu Protokoll: »Ich habe dieses vergangene Ereignis [den Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln im Jahr 2009, Anm. SF] Hand in Hand mit dem alten, dem antiken Drama, das ich auch, neben mir selbst, ja, wenn jemand Mißbrauch betreiben darf, dann ich mit mir selber!, verwendet habe, in die Gegenwart des Theaters gerissen.«53 Auf welche Weise aber spielen diese Texte (gegen) die Gegenwart des Theaters an? Und wie verhalten sie sich zu der vielschichtigen Wirklichkeit bei Aristophanes?
Die unmissverständliche Adressierung der politischen Gegenwart, die Jelinek und Aristophanes verbindet, stellt ein Spezifikum dar, das wir in der Tragödie grundsätzlich nicht vorfinden, wie die Altphilologin Johanna Hanink festhält:
Tragedy, too, commented upon and engaged deeply with social issues, political problems, and »current events« […], but because of its distinctive grammar and conventions comedy was able to do so more frankly, without the disguise of mythology. When Aristophanes wanted to lampoon Cleon he could do so by name or through thinly veiled parody; when he wanted to caricature Euripides, he could bring the tragedian – or at least a version of him – onto the stage.54
Es sind die Mittel des Komischen, die es Aristophanes und Co erlaubten, explizit an bestimmten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens Kritik zu üben. Interessanterweise aber richtete sich dieser Spott ursprünglich beinahe ausschließlich gegen Demokraten, namentlich hauptsächlich gegen Perikles und seine Nachfolger.55 Rechtsgerichtete Figuren wie Nicias, Laches, Alcibiades, diejenigen, die in die Skandale von 415 verwickelt waren, und die Oligarchen, die nach dem Putsch von 411 entrechtet worden waren, wurden fast vollständig verschont und gelegentlich sogar verteidigt. Und zwar auch noch dann, wenn die Rechten an der Spitze standen. Darüber hinaus zeugen die aus dieser Zeit überlieferten Komödientexte von den sozialen, moralischen, kulturellen und politischen Gesinnungen der konservativen Elite: Sie prangern die Volkssouveränität an sowie die Funktionsweise des Rates, der Versammlung und der Gerichte. Das immer wiederkehrende Problem der Oligarchie wurde von den Dichtern tunlichst gemieden. Stattdessen konzentrierte man sich darauf, das populistische Gespenst der elitären Tyrannei lächerlich zu machen.56
Wenngleich Jelineks Theatertexte den antiken Komödien in ihrer harschen Kritik um nichts nachstehen, so werden Politiker*innen darin meist nicht explizit benannt. Eine Ausnahme bildet der Theatertext Das Lebewohl, der sich auf äußerst direkte Art mit der politischen Lage Österreichs im Jahr 2000 auseinandersetzt und dabei konkrete Namen anführt, wie wir bereits in der einleitenden Regiebemerkung sehen:
(Einige schöne Knaben, die Gesichter zu einem ewigen Lächeln geschminkt, in kindlichen, pludernden Spielhöschen, umringen einen Mann, der ebenfalls den Mund zu einem zeitlos‐ewigen Lächeln gemalt hat und zu den Knaben spricht. Den Mund nicht grotesk‐clownhaft, sondern wirklich schön, aber etwas unheimlich, lächelnd, sie streuen dem Mann aus Körben Blütenblätter, die Knaben. Wenn es zu teuer ist, Knaben zu bekommen, kann man die Blütenblätter auch vom Schnürboden herunterwerfen lassen. Nein, Mädchen kann man nicht dafür nehmen. Der jeweils angesprochene Knabe wendet sich dem Sprecher des »Haidermonologs« in schöner, nachdenklich‐trauernder Pose zu, in der er eine Zeit lang erstarrt. Man kann es aber natürlich auch ganz anders machen. Es können auch alle Lederhosen tragen, von mir aus. Außerdem könnte eine Pythia oder ein schlichter griechischer Mann im Chiton mit dem Textbuch dabei sein und dem Schauspieler, der den Monolog spricht, auf die Sprünge helfen, den Text immer wieder mit ihm gemeinsam sprechen, wenn der Schauspieler stockt oder nicht weiter weiß. Das wäre gar kein Hindernis.)
Dank an: »news«, Aischylos (»Die Orestie«), übers. Walter Jens57
Jelinek verfasste den Text im Dunstkreis der international scharf kritisierten bzw. sanktionierten Regierungsbildung zwischen ÖVP und FPÖ. Jörg Haider hatte sich aus der Bundespolitik nach Kärnten zurückgezogen und seine Parteiobmannschaft innerhalb der FPÖ aufgekündigt. Bei Jelinek tritt er als »Sprecher« auf, der sich in einer Art Sieger‐Rede an eine Gruppe trauernder Knaben richtet und auf die vermeintlichen Gründe für seinen Rückzug eingeht. Als Intertexte verwendet die Autorin hierfür einerseits Haiders Text Glücksgefühl, der vom Boulevardmagazin News veröffentlicht worden war,58 und andererseits Die Orestie des Aischylos: »Mutter, warte noch! Ich komme wieder! Ich geh nur vorerst in mein Bundesland zurück. Für mich hat Einsamkeit nun keine Geltung mehr. Ich gehe und komme, Mann gegen Mann, Schwert gegen Schwert.«59 Haiders Rücktritt wird von Jelinek mithin als taktisches Manöver enttarnt. Seine Rede von einer »Wende«, die er selbst bewirkt habe, wird mit der in der Orestie thematisierten Wende vom Matriarchat zum Patriarchat enggeführt und in paratragischer Manier lächerlich gemacht.60 »Kinderlos wird ab sofort Frau bleiben: keine. Du aber du aber, großer Mund: ich selbst, bewache das Land und dieses Tor, durch das eh mehr darf: keiner. Ich sind: alle.«61 Als paratragisch kann auch die Mutation des Rachemotivs, um das die Orestie kreist, bewertet werden. Während Orest in der antiken Tragödie nach Hause gekehrt ist, um seinen Vater Agamemnon zu rächen, trachtet der Sprecher in Jelineks Fortschreibung nach Gerechtigkeit für die Generation von Nationalsozialisten, denen zu Unrecht Schuld zugemutet worden sei: »Wir haben keine Mitschuld an der Tat. Wir haben auch keine Morde befohlen. Das kann man von uns nicht sagen. Wir haben den Fall von Anfang an erörtert: wir warens nicht, und unsere Väter warens auch nicht.«62
Das Lebewohl ist vielleicht Jelineks direktester politischer Theatertext. Der Orest‐Haider‐Monolog nennt nicht nur Jörg Haider beim Namen, sondern auch die FPÖ‐Politiker*innen Dieter Böhmdorfer, Karl‐Heinz Grasser, Susanne Rieß‐Passer und Peter Westenthaler. Umso interessanter ist es, dass dieser Text Theatermachende aus Italien, Schweden und den Niederlanden dazu inspiriert hat, Bezüge zu rechtspopulistischen Regierungen im jeweils eigenen Land herzustellen. Regisseur Werner Waas beispielsweise blendete für die italienische Erstaufführung von Das Lebwohl (L’Addio, 2001) – die übrigens Jelineks Theaterdebüt in Italien bedeutete – auf einem Bildschirm Silvio Berlusconi ein, der durch stumme Lippenbewegungen Haiders Monolog begleitete.63 Bezeichnender Weise fand die Premiere ausgerechnet am Tag vor jenen italienischen Parlamentswahlen statt, aus denen Silvio Berlusconi als Sieger hervorgehen sollte. Waas erinnert sich an diese außergewöhnliche Aufführung, die im Teatro Rialto Occupatzo Sant’Ambrogio, also inmitten des römischen jüdischen Gettos, stattgefunden hat:
In der Stille, die sich zwischen dem Ende der Wahlkampagne und dem Trubel der Wahlen auftut, erklingen die Worte Jelineks klar und deutlich, inmitten jener Straßen und Gassen, die fast 60 Jahre vorher die Razzien der Nazis und die Schande der Rassengesetze erlebt haben. Alles ist klar und die Analogien zur italienischen Gegenwart sind so offensichtlich, dass es sogar zu befreienden Lachern kommt. Das für die da drin, draußen läuft eine ganz andere Geschichte ab. Am Tag darauf wird Silvio Berlusconi wiedergewählt mit einer erdrückenden Mehrheit.64
2016 publiziert Jelinek anlässlich der sogenannten Kornblumen‐Affäre rund um den Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer (FPÖ) eine gekürzte und leicht geänderte Version des Lebewohls auf ihrer Website. Der upgedatete Text nennt sich Das Kommen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Das Lebewohl, der sich explizit als »Haidermonolog« deklarierte, lautet die Regieanweisung nunmehr lapidar »Der Sprecher, welcher? Einer, der neuste.«65 Konkrete Namen werden hier nicht mehr genannt. Und doch gelingt es Jelinek, unmittelbare Assoziationen bei ihren (tagespolitisch informierten) Rezipient*innen auszulösen, und zwar mittels des ikonografischen Zitats der Kornblume – einstmals Erkennungszeichen der Nationalsozialisten. Die Abbildung dieser Blume, die Jelinek dem Text auf ihrer Website hinzufügt, stellt unmissverständlich einen Bezug zu den Schlüsselfiguren her, auf die der Text anspielt: Norbert Hofer hatte dieses florale Symbol im Zuge des Präsidentschaftswahlkampfs am Revers getragen und war dadurch einem in FPÖ‐Kreisen durchaus gängigen Brauch beigekommen.
In späteren Texten Jelineks fallen die ad‑personam‐Anspielungen deutlich kryptischer aus, wie man etwa anhand von Die Schutzbefohlenen beobachten kann. Dort treten die adressierten Vertreter*innen aus Politik und Kirche schlichtweg als »Stellvertreter von Stellvertretern von Stellvertretern«66 zutage. Ihnen gegenüber stellt Jelinek die Stimmen der Geflüchteten, die als »Gruppe, zusammengewürfelt aus Niemanden und Nichtsen, sicher aus Habenichtsen« (SCH) sprechen. Das Privileg, tatsächlich mit Namen genannt zu werden, bleibt ihnen verwehrt. Im Gegensatz dazu treten Persönlichkeiten auf, die sich vermeintlich verdienstvoll um Österreich angenommen haben, wie etwa der vielfach ausgezeichnete Fußballer David Alaba. Die Autorin konfrontiert diese identitätsstiftende Sportlerfigur mit den Geflüchteten aus Aischylos’ Hiketiden, die Pelasgos dazu drängen wollen, als König allein, d.h. ohne Konsultierung des Volkes, über ihre Aufnahme als Schutzbedürftige zu bestimmen:
Das Land ist du, nein, das denn doch nicht, das Land erlaubt, deine Vorstellungen jederzeit einzubringen, aber das erlaubt es nur dir, nicht nur dir, aber auch dir, vor allem dir, uns erlaubt es gar nichts, wir sind nichts, und uns wird nichts erlaubt, obwohl wir gern mitmachen würden, ist besser als zuschauen, nicht wahr, damit das Recht auch von uns ausgeht, damit das Recht auch vom Volk ausgeht, das dann auch wir sein werden, aber das Recht geht nicht, und wenn es ausgeht, dann macht es sich fein, dann brezelt es sich auf, aber wir dürfen nicht mit, man läßt uns nicht mal ins Lokal hinein, das ist nicht gerecht, obwohl das Recht auch von uns ausginge, zumindest ausgehen könnte, wenn es mal Freizeit hätte und wir unseren Traumpaß, den gestern leider der Herr Alaba verwandelt hat, oder hat er ihn vorbereitet?, und jetzt ist er nicht mehr da, ich meine der Paß, schon geschossen, nicht mehr da, nicht mehr erreichbar, der Herr Alaba ist in München, das Recht aber, das könnte auch von uns ausgehen, von mir aus, von uns aus, gehörten wir zu diesem Traum‐Volk, das Traumpässe schießt […]. (SCH)
Was passiert in dieser Passage? Jelinek wirft hier elementare Fragen von Inklusion und Exklusion im Zusammenhang mit dem Thema Demokratie und Asyl auf – und zwar in Rückbezug auf die Hiketiden, wo dem Altphilologen Christian Meier zufolge der Grundsatz der Volkssouveränität zum ersten Mal überhaupt literarisch verbürgt ist.67 Der zweite markierte Satzteil bildet wortwörtlich ein Scharnier zwischen dem antiken Prätext und der von Jelinek verarbeiteten politischen Gegenwart: Er zitiert sowohl Aischylos als auch den ersten Artikel der österreichischen Bundesverfassung, der da lautet: »Das Recht geht vom Volk aus.« In diesem Zusammenhang macht sich die Autorin die polysemantische Qualität des Begriffs »Paß« zunutze, der sowohl Assoziationen zu jenen Subjekten zulässt, die über keinerlei Identitätsnachweis verfügen, als auch zum österreichischen »Nationalidol« David Alaba.
Nicht explizit genannt und doch unmissverständlich adressiert wird zudem die Sopranistin Anna Netrebko, die 2006, ohne in Österreich zu leben bzw. ohne Deutsch zu sprechen, die österreichische Staatsbürgerschaft erhielt: »Die muß nicht die Gabel machen, nicht die Beine breit für jeden, der ihr ein Kurzvisum erteilt, eine Arbeitserlaubnis, der muß man keine Erlaubnis erteilen, die muß man bitten, auf Knien bitten, weil sie die Gabe dieser einmaligen Sopranstimme besitzt, die Sie schon so lang gesucht haben […]« (SCH). Der Text zeigt mithin in betont kalauernder Manier den Spalt auf, der zwischen denen besteht, die vergeblich und unter menschenunwürdigen Bedingungen um Asyl ansuchen, und jenen, die dank ihres vermeintlichen Verdiensts um Österreich blitzeingebürgert werden.68
Zur Perfektion getrieben hat Jelinek das Verfahren der ad‑personam‐Attacke in den beiden Theatertexten Am Königsweg (2017) und Schwarzwasser (2019). Am Königsweg entstand anlässlich von Donald Trumps Wahlsieg bei der US‑amerikanischen Präsidentschaftswahl im Herbst 2016.69 Wenngleich sein Name über das gesamte Stück hinweg nicht genannt wird, so machen die impliziten Verweise auf Trumps fragwürdigen Politik‐ bzw. Twitterkommunikationsstil deutlich, um wen es geht: »Niemand muß den König mehr anschauen, es genügen seine Fotos, dort wo wir leben, wir leben, er lebt lieber woanders. Und es genügt sein Gezwitscher, vögeln tut er woanders.«70 Das Wir, das hier spricht, lässt sich als eine an den Folgen des Turbokapitalismus laborierende, im Hass geeinte Gesellschaft lesen, die sich auf der unentwegten Suche nach einem Sündenbock befindet.
Intertextuell rekurriert Jelinek in Am Königsweg sowohl auf Sophokles’ König Ödipus als auch auf die Abhandlung Das Heilige und die Gewalt, in der René Girard seine viel beachtete mimetische Theorie erläutert – und zwar ebenfalls mithilfe der Figur des Ödipus.71 So behauptet Girard, dass die scheinbaren Unterschiede zwischen den Protagonist*innen innerhalb der sophokleischen Tragödie durch einen bestimmten Affekt getilgt würden, der sie alle eint, nämlich durch jenen des Zorns: »Weit davon entfernt, sich deutlich als eigenständige Wesen zu profilieren, indem sie sich voneinander abheben, lassen sich die Protagonisten auf die Identität ein und derselben Gewalt reduzieren; der Sog, in den sie geraten, macht sie alle gleich.«72 Die Gemeinschaft finde sich im Hass geeint wieder, der kollektive Groll richte sich gegen eine einzelne Gruppierung, gegen das »versöhnende Opfer«, wie es bei Girard heißt. Bei Sophokles adressiere dieser Hass Ödipus, der zwar »nicht schuldig im modernen Sinn [ist], aber er ist für das Unglück der Stadt verantwortlich. Seine Rolle ist die eines eigentlichen menschlichen Sündenbocks.«73 Wie aber verfährt Jelinek mit dieser Theorie? Sie greift auf die Überlegungen Girards zurück, indem sie die Figur des Ödipus in paratragischer Manier mit Donald Trump überblendet: »Der König ist am Niedergang der Stadt schuldig, allein weil er gekommen und jetzt da ist. Weil er ist, der er ist. Er hat die ungeheuerliche Übertretung begangen, daß er sich von uns zum König wählen ließ. Jetzt ist er halt verantwortlich. Er ist überreich an Schuld, er hat so reichlich Schuld, daß keine mehr übrig ist.«74
Die Frage nach dem Verhältnis von Macht und Gewalt steht auch im Zentrum des 2019 verfassten Stücks Schwarzwasser, das einmal mehr den Manipulationsmechanismen der Politik nachspürt und dabei ebenfalls Schriften René Girards verarbeitet (»Etwas René Girard, bitte sehr, hatte ich noch vorrätig und eingerext«75). Der Text stößt sich an der sogenannten Ibiza‐Affäre ab und spielt auf die darin involvierten Politiker an, allen voran auf den ehemaligen FPÖ‐Parteiobmann und Vizekanzler Heinz‐Christian Strache und auf seinen Kollegen Johann Gudenus, ehemals geschäftsführender FPÖ‐Klubobmann und Abgeordneter zum Nationalrat. Die beiden hatten sich 2017 mit einer vermeintlichen Oligarchen‐Nichte in einer Finka auf Ibiza getroffen und sich zu Aussagen hinreißen lassen, die ihre Bereitschaft zu Korruption, illegaler Parteienförderung und verdeckter Kontrolle von unabhängigen Medien demonstrierten. Das ohne deren Wissen aufgezeichnete Gespräch war Journalist*innen von Spiegel und Süddeutsche zugespielt worden, die am 17. Mai 2019 Teile daraus veröffentlichten. Einen Tag später kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz die Koalition mit der FPÖ auf.76
In Schwarzwasser begegnete Jelinek dieser international viel beachteten Affäre mit einer Fortschreibung der euripideischen Bakchen. Sie nahm sich also einer Tragödie an, auf die sie auffallend häufig zurückgreift.77 In Schwarzwasser steht das invertierte Opfer im Vordergrund, das sich in den Bakchen in der Orgie der Mänaden materialisiert. Jelinek greift dieses Motiv auf und konfrontiert es auf paratragische Art mit mutierten Zitaten von Heinz‐Christian Strache, der sich angesichts des kolportierten Videos selbst als Opfer einer Verleumdungskampagne inszenierte:
Alle raus! Alle sind natürlich wieder mal gegen uns, sie sind unsre Gegner, das sehen wir, das sehen Sie ja auch!, wer würde ein besseres Opfer abgeben als wir? Inzwischen sehen Sie es noch besser, weil wir uns ins Bild der Überwachungskamera gesetzt haben! Dort sitzen wir bequem, wissen es aber noch nicht. Die Opfer wurden ins rechte Licht gerückt und dann ins Bild gesetzt. Wir sind also im Bilde, hätten wir das nur gewußt, daß wir wenigstens einmal im Bilde waren, daß wir Opfer waren!, aber nachträglich ist da nichts mehr zu machen, das Bild ist bereits bei unseren Feinden angekommen, unsere Freunde kennen uns ja, sie kennen uns nur als Opfer, die brauchen kein Bild von uns, die haben sich längst ein eigenes gemacht. Sehen Sie gut?, sehen Sie scharf? Sehen Sie wie scharf diese Frau ist? Ein Wahnsinn.78
Mit der Opfer‐Täter*innen‐Umkehr, die in dieser Passage vollzogen wird, demaskiert der Text eine zentrale rechtspopulistische diskursive Strategie, derer sich neben Heinz‐Christian Strache auch andere Parteikolleg*innen regelmäßig bedienen.79 Bei Jelinek werden sie zwar nicht namentlich genannt, jedoch (zum Teil wörtlich) zitiert. So erscheint etwa der ehemalige Innenminister und heutige FPÖ‐Klubobmann Herbert Kickl in Form seiner im Jänner 2019 getätigten Aussage »Das Recht muß der Politik folgen.«80 Hat dieser Sager ursprünglich lautstarken Protest vonseiten der Opposition ausgelöst, so fungiert er in Schwarzwasser schlichtweg als Stichwort für die Anspielung auf eine weitere Schlüsselperson des von Jelinek persiflierten rechten Lagers. Die Rede ist hier von Straches Gattin Filippa, die zum Zeitpunkt des beschriebenen Skandals Tierschutzbeauftragte der FPÖ war: »Die Politik muß uns folgen. Die Kinder müssen uns auch folgen, ja, auch der Hund muß folgen, dieser Hund zum Beispiel muß der neuen Tierschutzbeauftragten folgen.«81
Die Lustquelle des komischen Spiels, das Jelinek und Aristophanes im Miteinbeziehen prominenter Persönlichkeiten vorantreiben, deckt sich mit jener, die Freud für das Hantieren mit Reimen, Alliterationen und anderen Arten der Wiederholung bestimmt, nämlich »das Wiederfinden des Bekannten,«82 das eine »Erinnerungslust«83 evoziere.84 Besonders stelle sich eine solche Lust im »Moment der Aktualität« ein, das für jene Witze eine wesentliche Rolle spiele, die »Anspielungen auf Personen und Begebenheiten [enthielten], die zur Zeit ›aktuell‹ waren, das allgemeine Interesse wachgerufen hatten und noch in Spannung erhielten.«85 Doch seien solche Witze nur von gewisser Halbwertszeit, ihre Lebensdauer setze »sich aus einer Blütezeit und einer Verfallszeit zusammen« und endige schließlich »in völliger Vergessenheit.«86
Inwiefern diese Beobachtung Freuds auf die ad‑personam‐Attacken innerhalb von Jelineks Theatertexten zutrifft, wird die Zeit weisen. Zusammenfassend kann jedenfalls festgehalten werden, dass das paratragische Verfahren der ad‑personam‐Attacke, das für die Komik des Aristophanes so charakteristisch ist, sich auch für Jelineks Theatertexte als konstitutiv erweist. Die Autorin adressiert Personen des öffentlichen Lebens direkt oder indirekt, indem sie sich auf diskursive oder auch auf ikonografische Zitate stützt. Die in diesem Zusammenhang an‑gespielten Personen erscheinen in Form von Sprachmasken oder figurieren als Stichwortgeber*innen, die die Grenzen zwischen Realität und Fiktion, zwischen Tragischem und Komischem durchlässig erscheinen lassen. Den einzelnen Personen, die Jelinek in ihren Texten angreift bzw. die darin auftreten, steht das dominante Wir gegenüber, dem sich die vorangegangenen Kapitel auf unterschiedliche Weise gewidmet haben. Wie nun aber verhält sich diese chorische Figuration zu der konstatierten paratragischen Ästhetik der Autorin?
6.2.2 Chorisches Sprechen zwischen tragoidia und comoidia
Die Befragung des Chorischen stellt innerhalb des (post‑)dramatischen Werks von Elfriede Jelinek fraglos den zentralen Bezugspunkt zum Theater der griechischen Antike dar, wie aus Ulrike Haß’ Überlegungen zur Theaterästhetik der Autorin hervorgeht:
Mit seinen Merkmalen des Schon‐da, der Eröffnung (An‐Sprache) und der Einräumung, die über die Bühne hinaus auf jenen Raum des Verlautbarens und Hörens hindeuten, den das Theater insbesondere durch sein Publikum bildet, ist das Chorische formsemantisch grundlegend für Stücke wie Ein Sportstück, Das Werk, Bambiland, Rechnitz (Der Würgeengel) und Ein Sturz.87
Die damit verknüpften poetologisch‐dramaturgischen Verfahren haben Regisseur*innen wie Einar Schleef, Nicolas Stemann, Karin Beier und Claudia Bosse dazu inspiriert, »die verschüttete Geschichte des Chors«88 freizulegen und innovative ästhetische Zugänge für ein Denken »von erwünschter oder erlittener Zugehörigkeit«89 zu entwickeln. Auch in der Forschung hat das Chorische bei Jelinek in den letzten Jahren für großes Interesse gesorgt und eine schier unüberblickbare Fülle an Publikationen hervorgebracht. Das erstaunt insofern, als die akademische Auseinandersetzung mit Jelineks Bezügen zum Tragischen abgesehen von der Erforschung des Chors nach wie vor in den Kinderschuhen steckt. Aber rufen die pluralen und polyphonen Figurationen, die Jelineks Theatertexte bewohnen, (ausschließlich) den tragischen Chor auf? Oder legt die auffallend intensive Bezugnahme auf den Chor nahe, (auch) an den komischen Chor der Antike zu denken?
Tatsächlich spielt der Chor in der Alten Komödie eine weitaus größere Rolle, als er dies innerhalb der Tragödie tut. Das zeigt sich bereits daran, dass viele der uns erhaltenen Komödien nach dem Chor benannt sind (Die Vögel, Die Frösche, Die Ritter, Die Acharner, Die Wespen etc.). Darüber hinaus wird seine Relevanz von den für ihn vorgesehenen extravaganten, opulenten Kostümen hervorgehoben. In Komödien wie Die Wespen, Die Ritter und Die Acharner wird der Auftritt des Chors über einen langen Zeitraum vorbereitet, was beim Publikum eine spezifische Vorfreude auf das Erscheinen der bunten Truppe evoziert haben muss. Zudem ging Aristophanes so weit, einzelne Chormitglieder differenziert auszugestalten – etwa in der Vorstellung sämtlicher 24 Vögel im gleichnamigen Stück. Im Gegensatz dazu tendiert der tragische Chor zumindest in der Nachfolge Aischylos’ dazu, als mehr oder minder homogene, geschlossene Figuration aufzutreten und im Hintergrund zu verweilen. Aristophanes’ Thesmophoriazusen als Beispiel aufgreifend, hebt Anton Bierl für den komischen Chor Folgendes hervor:
Die zielgerichtete »anderweitige« Handlung oder das Sujet ist nicht nur vom lächerlichen Episodenhaften auf der Schauspielerebene, sondern vor allem auch von chorischen Auftritten überlagert, die weitgehend auf den pragmatischen Rahmen verweisen und nahezu reine Präsenz ausdrücken. Mehrere Lieder scheinen die Handlung zu unterbrechen und weitgehend aus ihr herauszufallen. Götterkult, Gebet und Tanz stehen fast selbstzweckhaft für sich und sind nur ganz lose mit den fiktionalen Ereignissen verbunden. Die Äußerungen sind gleichzeitig selbständige Handlungen im Hier und Jetzt, die den Kult der Polis stützen.90
Der Chor artikuliert mithin eine spezifische Selbstreferenzialität, der eine metatheatrale Funktion zukommt. Er ist nicht Handlanger eines vordergründigen Plots, sondern hebt das festlich‐agonale Framing der performativen Aufführungssituation hervor. Der komische Chor steht nicht im Dienst einer kohärenten Erzählung, sondern er unterbricht diese wieder und wieder. Als Figuration der Zäsur markiert er mithin ein genuin gestisches Theater, das bei Jelinek nachlebt. Auch hier tritt der Chor als intermittierende Instanz auf, als (ver‑)störende Entität, in der Warnung, Kommentar und Bericht wie in einem dialektischen Bild zusammenfallen.
Die große Bedeutung, die Jelinek dem Chorischen beimisst, zeigt sich bereits in Ein Sportstück, wo sich die Autorin in einer vielfach bemühten Regieanweisung wie folgt äußert: »Machen Sie, was Sie wollen. Das einzige, was unbedingt sein muß, ist: griechische Chöre. […].«91 Der Chor besteht hier – in der monumentalen, achtstündigen Uraufführung am Burgtheater von Einar Schleef eindrücklich in Szene gesetzt – ausnahmslos aus Sportler*innen: »[…] wer immer auftreten soll […], muß Sportbekleidung tragen, das gibt doch ein weites Feld für Sponsoren, oder? Die Chöre, wenns geht, bitte einheitlich, alles adidas oder Nike oder wie sie alle heißen, Reebok oder Puma oder Fila oder so« (SP, S. 7). Inwiefern mit der Installation solcher chorischer Figurationen Strategien der griechisch‐antiken Komödie recycelt werden, zeigt sich aber erst im Theatertext das Das Werk (2001), wo wir es – wie die vorangestellte Regiebemerkung ankündigt – mit der paradoxalen chorischen Vervielfältigung einer Kinderbuchfigur zu tun haben, nämlich mit der des Geißenpeter aus Johanna Spyris Kinderbuch Heidis Lehr‐ und Wanderjahre (1880):
Etliche Geißenpeter in ihrer Geißenpetertracht treten auf und hüten ihre Geiseln, die fröhlich um sie herumspringen. Sie müssen nicht gehütet werden, denn sie bleiben ja freiwillig bei uns, weil es hier so schön ist. Doch die Peter tun brav ihren Job, aber weil sie ja nicht viel zu tun haben, nicht mehr als an Grashalmen lutschen, auf ihrem Schwanz pfeifen (also ich meine nicht, daß sie auf ihren Schwanz pfeifen würden) und dieses Dingsda‐Bier trinken, das man auf der Alm trinkt, ist das Egger Bier?, damit man einen Almrausch kriegt, teilen sie sich den folgenden Text untereinander auf. Wie sie das machen, ist mir inzwischen bekanntlich so was von egal. Heidi kann in diesem Augenblick noch solo sein, muß aber nicht. Nach Belieben können jederzeit noch mehr Heidis hinzukommen.92
Das Werk thematisiert den 1938 von Hermann Göring angeordneten und mithilfe von Zwangsarbeiter*innen und (hauptsächlich russischen) Kriegsgefangenen erfolgten Bau des Speicherkraftwerks Kaprun. Fertiggestellt 1955, d.h. im Jahr der Unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrags, firmiert dieses Bauwerk, wie der Internetauftritt des Kraftwerks heute titelt, »als Sinnbild für den Wiederaufbau Österreichs.«93 Tatsächlich freilich gerierte sich die Zweite österreichische Republik bis in die späten 1980er‐Jahre hinein als erstes Opfer des Nationalsozialismus, anstatt seine Mitschuld an den NS‑Verbrechen und am Zweiten Weltkrieg einzugestehen. Dieser von der Politik jahrzehntelang bemühte und in einigen österreichischen Köpfen immer noch nachlebende »Opfermythos« trifft in Jelineks Theatertext auf die tatsächlichen Opfer, die der Bau des Kraftwerks gefordert hat, nämlich die zahlreichen Zwangsrekrutierten, aber auch die alpine Natur. In der Nachbemerkung zu Das Werk, das gemeinsam mit dem Theatertext In den Alpen94 publiziert worden ist, liest man:
Ich habe in diesem Stück, das dem verstorbenen Einar Schleef gewidmet ist, versucht, etwas über »den« Arbeiter zu schreiben. Der Sportler wie der Arbeiter sieht in den Bergen einerseits Herausforderung, andererseits Arbeitsgerät. Die einen betätigen sich zum Spaß an den Bergen […], die anderen vollbringen ein monströs‐gigantisches Aufbauwerk.95
Auffallend an der chorischen Figuration der Geißenpeter, die Jelinek in der weiter oben zitierten Regiebemerkung installiert, ist deren groteske Körperlichkeit. Das texttheatrale Verfahren inszeniert sie als sexualisierte, dem Exzess frönende Formation und nähert sie dadurch unverkennbar der burlesk‐derben Erscheinung des Chors an, die uns in der aristophanischen Komödie begegnet. Die Grashalme lutschenden und auf ihren Geschlechtsteilen pfeifenden Geißenpeter wecken Assoziationen zu den antiken komischen Choreuten, die – ähnlich wie im Satyrspiel – ausnahmslos mit überdimensionalen, ledernen Phalli ausgestattet waren.
Dem Chor der Geißenpeter gegenüber steht im Epilog der Chor der Mütter, der an Einar Schleefs monumentales Antikenprojekt Mütter (1986) denken lässt, für das der Autor und Regisseur Aischylos’ Sieben gegen Theben und Euripides’ Die Schutzflehenden übereinanderlegte. Jelinek wiederum zieht den Chor der Mütter aus den Troerinnen des Euripides ab und lässt ihn in Das Werk um jene trauern, die »von den Geschichtsbildenden zu den Gesichtslosen […], zu Material der Geschichte«96 gemacht worden sind. Der Epilog setzt mit folgender Bemerkung ein:
Auf der Dammkrone erscheinen die Mütter und sagen ebenfalls, was sie zu sagen haben. Aber niemand hört ihnen zu. Es ist, als ob sie die Wahrheit mitsamt ihrem völlig unbegründeten Wesen, und dieses hätte nun wirklich Zeit gehabt, sich zu begründen, vorstellen wollten. Aber die Wahrheit hat keine Manieren und benimmt sich völlig blöd hier heroben, wo sie sich eh nicht auskennt. Außerdem hat sie die falschen Schuhe an, und alles bangt jetzt, ob das Denken dieser Frauen auf der Dammkrone in dieser bildlosen Dichtung oder was das ist nicht einen furchtbaren Schaden anrichten wird, wenn die da so stehen und in die Ferne schauen, die Mütter, ob sie ihre längst verstorbenen Söhne, und sie selber sind ja auch tot, ob sie die noch irgendwo sehen […]. (WE, S. 239)
In Anspielung auf den Chor der Mütter, der bei Euripides dazu verdammt ist, auf die Rückkehr der (toten) Söhne zu warten, differiert der Epilog radikal vom restlichen Theatertext Das Werk. Im Gegensatz zum ersten und zweiten Teil gelangt hier nämlich eine typisch paratragische Strategie zum Einsatz, derer sich auch Aristophanes häufig bedient: das Sampeln vulgärer lexikalischer Einheiten mit poetischen Ausdrücken und Interjektionen. Offensichtlich wird dieses Verfahren bereits aus den ersten Zeilen des epilogischen Sprechtexts:
Die Mütter (immer schön eine nach der anderen, es kommen alle dran, nur nicht drängeln!):
Wie lieg ich rücklings hingestreckt auf diesem steinharten Lager! O weh, mein Kopf, und meine Schläfen tun mir auch weh und mein Arsch erst! (WE, S. 240, Herv. SF)
Das Pathos, das hier durch das Bemühen des tragischen Registers erzeugt wird, kollidiert mit der derben Lexik, die dabei gleichzeitig zum Einsatz gelangt. Kontrastierend wirkt zudem der Gebrauch einer umgangssprachlichen Ausdrucksweise, namentlich von Ellipsen und floskelhaften Redewendungen: »Wer sagt, leb wohl, Mutter, weine nicht? Keiner sagt, leb wohl, Mutter, weine nicht. Auch gut« (WE, S. 244, Herv. SF), »Welch ein Wehgeschrei, welche Trauer, oje, das ist wirklich traurig. Die ist weg wie Troja, da gibt’s nichts. Das tut uns jetzt sehr leid für diese Stadt, aber sie ist weg« (WE, S. 246, Herv. SF).
Inwiefern Jelinek im Rückgriff auf den tragischen Chor komische Effekte erzielt, zeigt sich auch am Beispiel des Theatertexts Ein Sturz, den Karin Beier gemeinsam mit Das Werk und mit dem für Christoph Schlingensief verfassten Text Im Bus am Schauspiel Köln zur Uraufführung brachte.97 Ein Sturz entstand als Antwort auf den Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln, der sich im März 2009 im Zusammenhang mit dem Ausbau der Kölner Nord‐Süd‐Stadtbahn zutrug. Zum Zeitpunkt des Archiveinsturzes befand sich die Baugrube der zu errichtenden Gleiswechselanlage Waidmarkt unmittelbar vor dem Archivgebäude und wurde durch Schlitzwände gegen das Grundwasser abgedichtet. Das nachfließende Wasser wurde kontinuierlich durch Brunnen abgepumpt. Kurz vor dem Eintritt des Unglücks bemerkten Bauarbeiter einen Wassereinbruch und warnten Anrainer*innen, Verkehrsteilnehmer*innen sowie Mitarbeiter*innen und Nutzer*innen des Archivs vor der Gefahr. Die Warnungen erreichten jedoch nicht alle – zwei Männer kamen ums Leben und 36 Menschen verloren ihre Wohnung.98 Darüber hinaus wurde mit dem Verlust des Historischen Archivs ein unvergleichlicher Ort des Gedächtnisses ausgelöscht. Als Ursache des Einsturzes wurde ein Leck in der Schlitzwand vermutet, durch das kontinuierlich Wasser in die Baugrube nachgeflossen war. Im Laufe der Untersuchungen zum Einsturz ergaben sich jedoch erhebliche Regelverstöße beim gesamten Bau der Bahn; so wurden beispielsweise unzureichende Kontrollen der Grundwasserförderung, die Errichtung von 19 illegalen Brunnen sowie eine unzureichende Bauaufsicht durch die Kölner Verkehrsbetriebe aufgedeckt.99
Der Theatertext Ein Sturz begegnet den Verstrickungen von Warnung, Vorwurf und Klage, die die Kölner Causa aufruft, indem er intertextuell an den ersten Teil der Orestie des Aischylos anknüpft, nämlich an Agamemnon. Wenngleich wir es bei Ein Sturz im Gegensatz zu Das Werk nicht mit dezidierten Sprecher*innenangaben zu tun haben, so legt Jelinek auch hier nahe, den Text chorisch zu inszenieren:
Die einzelnen Abschnitte bedeuten gleichzeitig auch die Aufteilung auf die Sprecherinnen und Sprecher oder Chöre, je nachdem, ganz wie gewünscht. Ich stelle mir etwas desolate, zurückgebliebene Gestalten vom Rosenmontagszug vor, der ja nur eine Woche vor dem Einsturz des Archivs stattgefunden hat. Und bitte, wenn möglich, sollten auch wieder Plüschtiere dabeisein!100
Die Überblendung der dem Theatertext zugrunde liegenden Katastrophe mit der Kölner Karnevalstradition macht die Gleichzeitigkeit von Tragischem und Komischem unmittelbar erfahrbar. Sie lässt an eine Passage aus Platons Nomoi denken, in der sich der Philosoph dem Tanz widmet, d.h. einer Kulturtechnik, die sowohl für den tragischen als auch für den komischen Chor strukturbildend ist. Platon teilt dort den Tanz in zwei Kategorien ein, nämlich in den sogenannten ernsten, von schöneren Körpern vollzogenen (spodeion) und den komischen, von hässlicheren Körpern ausgeübten Tanz (phaulon).101 In diesem Zusammenhang kommt er zu folgendem Schluss: »[…] ohne das Lächerliche kann man auch das Ernste nicht begreifen, so wie sich überhaupt eine Einsicht in das Entgegengesetzte immer nur aus dem Entgegengesetzten gewinnen lässt […].«102 Die desolaten Gestalten vom Rosenmontagszug, die Jelinek ins Spiel bringt, versinnbildlichen dieses Paradox. Sie rufen das Karnevaleske auf, das Michail Bachtin zufolge einer »Gegenwelt gegen die offizielle Welt«103 entspricht und dabei ein durchaus gespaltenes Lachen evoziert. Zum einen kommt diesem Lachen eine entlastende Funktion zu. Es erlaubt, die furchteinflößende Macht von Staat und Kirche für einen gewissen Zeitraum zu vergessen. Zum anderen erweist es sich als ambivalent, denn Bachtin zufolge hat der Mensch des Mittelalters »an zwei Leben gleichmäßig teil: am offiziellen Leben und am Karnevalsleben […].«104
Die Verstrickung von Komischem und Tragischem, die Jelinek explizit und implizit in der oben zitierten Regiebemerkung herstellt, materialisiert sich in der janushäuptigen Figuration des Chors, die in Ein Sturz auftritt. Einerseits ruft das unbestimmte Wir, das im Theatertext spricht, die dionysische Fest‐ und Umzugskultur, in der die Alte Komödie wurzelt, ins Gedächtnis. Andererseits gemahnt es an den tragischen Chor, namentlich an den Chor der Greise aus dem intertextuell herangezogenen Prätext Agamemnon. Aischylos gestaltet diesen Chor als intellektuell und politisch vor den Weissagungen der Seherin Kassandra kapitulierendes Kollektiv. Er führt einen Haufen jammernder alter Männer vor, die zu schwach gewesen waren, um in den Krieg zu ziehen, und stattdessen in Argos blieben. Nun erheben sie Klage über die zahlreichen Opfer, die der Krieg gekostet hat. Die Resignation, die von dieser Figuration ausgeht, hallt bei Jelinek nach: »Wir sehen […] keine Hindernisse. Wir schauen aber nicht nach. Sicher ist sicher. Sonst sehn wir noch was und müssen bestatten unter Geschrei die Toten des Hauses« (ES, S. 31). Im Gegensatz zur antiken Tragödie aber steht dem Wir, das hier hörbar wird, kein Herrscher gegenüber, wie die Dramaturgin Rita Thiele anlässlich der Uraufführung von Ein Sturz unterstreicht: »Die Mächtigen der Stadt, die Stadtväter, die Banken, die Zeitungen, die Firmen: Sie haben sich unter den Chor gemischt, sind in ihm aufgegangen.«105 Zu Wort kommt ein vielstimmiges Konglomerat aus Politiker*innen, Täter*innen, Opfern und Beschwichtigenden, die einander insofern ähneln, als sie allesamt die Schuld von sich und sie auf Erde und Wasser projizieren:
Bist du auf Diät oder was, Erde, daß du nur Wasser willst und sonst nichts? Ausgerechnet? Nichts einfacher als das. Schon zuckt hell dein Strahl wie ein männliches Glied, du zuckst, Wasser, ja, du bist gemeint!, du springst herum, du dringst ein, du spritzt ab!, die Erde ist ja so scharf auf dich. (ES, S. 31)
Ähnlich wie bereits in Bezug auf Das Werk beobachtet, wird dabei auch hier Pathos durch den Rückgriff auf Aischylos hergestellt und sofort wieder gebrochen. Der hell zuckende Strahl ist Oskar Werners Agamemnon‐Übersetzung der Verse 300–304 entlehnt. Er alludiert auf das Signalfeuer, das Klytaimnestra über die Eroberung Trojas informiert und das ihr die Rückkehr des Gatten Agamemnon ankündigt. Jelinek, die sich die Polysemie des Begriffs »Strahl« zunutze macht, ruft dadurch jedoch weniger den hehren, Hoffnung und Euphorie generierenden Schein des Feuers ins Bewusstsein als vielmehr die abgesonderten Flüssigkeiten des männlichen Gliedes. Das sprachliche Verfahren, das diesen bemerkenswerten Kippeffekt erzeugt, wird in der Wissenschaft gerne mit Freuds Ausführungen zum Witz in Verbindung gebracht.106 Hingegen unbeachtet blieb bislang Jelineks Nähe zu Aristophanes, der auffallend intensiv mit Paronomasien arbeitete. Grund genug, um die ästhetischen Strategien, derer sich die beiden Autor*innen im Rückgriff auf die Tragödie bedienen, miteinander in Relation zu setzen.
6.2.3 Sprachliche Verfahren des Paratragischen
In einem E‑Mail‐Wechsel mit Monika Meister beschreibt Ulrike Haß die Verfahren des Komischen bei Jelinek als »reines Gelenkwissen. Reines Sprachgelenkwissen, mit dem etwas in der Sprache gebrochen wird, […] auch aufgebrochen.«107 Welcher spezifischen Gelenke aber – um bei dieser Metaphorik zu bleiben – bedient sich Jelinek, um die Sprache zu brechen? Und wie geht sie dabei konkret vor?
Es erscheint mir wichtig, dieser Frage differenziert zu begegnen. Tatsächlich nämlich bezieht sich Jelinek in ihren (post‑)dramatischen Werken auf völlig unterschiedliche komische Traditionen – etwa auf den jüdischen Witz, die Sprachkomik eines Karl Kraus, die komisch‐grotesken Ästhetiken der bildenden Künstler Paul McCarthy und Mike Kelley oder auf das literarische und popkulturelle Genre des Nonsens. In der Forschung wurde bislang vor allem den die früheren Stücke Jelineks prägenden Bezügen zur Tradition des Altwiener Volkstheaters ein großes Interesse entgegengebracht. Burgtheater (1982) etwa referiert auf das Genre des Zauberspiels, der Posse und auf das Allegorische Zwischenspiel und spinnt Ferdinand Raimunds Der Alpenkönig und der Menschenfeind weiter. Die 1987 entstandene Waldheim‐Persiflage Präsident Abendwind orientiert sich an Johann Nepomuk Nestroys Häuptling Abendwind. Auch über diese konkreten Bezüge hinaus wird Jelineks inflationärer Gebrauch von Intertextualität sowie von Kalauern, Alliterationen und Neologismen immer wieder mit der Theaterästhetik des Altwiener Volkstheaters in Verbindung gebracht.108 Unbeachtet blieb bislang der Umstand, dass wir solcherlei komische Spielarten bereits bei Aristophanes in Hülle und Fülle vorfinden.
Intertextualität
Als eines der elementaren Verfahren innerhalb von Jelineks Theaterästhetik kann die Verschränkung von hohem und niederem Register beschrieben werden. Die Theatertexte der Autorin mischen, so die Literaturwissenschafterin Teresa Kovacs, »Hochkultur mit Trivialem, sie kombinieren die zitierten Dramen mit Versatzstücken aus weiteren literarischen Texten, aus religiösen und philosophischen Schriften sowie mit Zitaten aus journalistischen Beiträgen, aus Fernsehserien und Schlagersongs.«109 Mit der spezifischen Intertextualität, die damit einhergeht, schließen Jelineks Arbeiten laut Juliane Vogel »an avantgardistische Praktiken der Textproduktion an […], die den Text nicht mehr als eine von souveränen Autorsubjekten generierte organische Ganzheit, sondern als eine Konfiguration fragmentierter Prätexte entwerfen […].«110 Pate stünden der Autorin dabei zunächst die politischen Montagen der 1920er‐ sowie Brechts Theaterästhetik der 1950er‐Jahre. Als prägend für Jelineks Montage‐ und Collagetechniken listet Vogel darüber hinaus österreichische Literaturtraditionen und führt namentlich Johann Nepomuk Nestroy und Karl Kraus an. Bezüge zum antiken Theater aber stellt die Literaturwissenschafterin in ihrem im Jelinek Handbuch erschienenen Grundlagenbeitrag zum intertextuellen Schreibverfahren Jelineks nicht her.
Tatsächlich jedoch ruft die zwischen Tragischem und Komischem, zwischen vermeintlich Hehrem und Derbem mäandernde Intertextualität Jelineks eine Strategie auf, die sich als konstitutiv für Aristophanes’ Komödien erweist. Aristophanes entlehnt bestimmte Ausdrücke aus einzelnen Tragödien und ähnlichen vermeintlich unantastbaren Prätexten und montiert diese gemeinsam mit alltagssprachlichen, oftmals vulgären Floskeln zu einem eigentümlichen Potpourri. Pointierte Kürze trifft dabei auf extravagante Fülle, erhabene poetische Bilder prallen auf rohe, direkte Obszönität, umgangssprachliche Offenheit mischt sich mit subvertiertem Pathos. Das Material, aus dem Aristophanes in diesem Zusammenhang schöpft, ist mannigfaltig. Der Dichter nimmt Anleihen aus dem homerischen Epos, den neuen Dithyramben, aus Gebeten und Hymnen, aus dem zeitgenössischen wissenschaftlichen und politischen Diskurs sowie aus unterschiedlichen Dialekten.
Jedoch wäre es ein Irrtum, dieses intertextuelle Verfahren als genuin komisch zu bezeichnen. Tatsächlich, so hat der Philologe Donald Mastronarde angemerkt, speist sich auch die Tragödie aus völlig unterschiedlichen Tex(tsor)ten: »Tragedy, at least as we know it in the fifth century, is inherently a genre of varied form and content. […] The anapaestic and choral parts, however, borrow from or appropriate other genres, such as processional, hymn, formal lament, epinician, wedding‐song etc.«111 Ähnliches gilt für Wortneuzusammensetzungen und Neologismen, die wir nicht nur in der Komödie vorfinden, sondern auch in der Tragödie und in den Dithyramben – jedoch mit einem entscheidenden Unterschied. Werden sie in den »ernsthaften« Genres eingesetzt, um Erhabenheit zu erzeugen, so dienen sie bei Aristophanes ganz im Gegensatz dazu, Komik zu produzieren. Ein diesbezügliches Beispiel liefert das unaussprechliche, aus allen möglichen Leckereien bestehende Gericht, das am Ende von Frauen in der Volksversammlung (392 v. Chr.) erwähnt wird und das folgendermaßen lautet: »Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphiokarabomelitokatakechymenokichlepikossyphophattoperisteralektryonoptokephalliokinklopeleiolagoosiraiobaphetraganopterygon.«112 Der Anschaulichkeit halber sei Niklas Holzbergs deutsche Übersetzung dieses aus 79 Silben und 170 Buchstaben bestehenden Neologismus hier angeführt:
Chor:
Denn bald gibt es
Schüsselschnetzelrochenhaifisch‐
hirnwurstessigrettich‐
knoblauchkäsehonigsoße‐
drosselamselringelturteltauben‐
hähnchengrillhirnschnepfenwachtel‐
hasensiruptunken‐
schlemmerflügel. (Arist. Fr. 1169–1178)
Die Altphilologin Stephanie Nelson hat darauf aufmerksam gemacht, dass viele der von Aristophanes eingesetzten komischen Mittel gemäß einer Logik funktionieren, die unsere Aufmerksamkeit auf Diskrepanzen lenkt.113 Dies zeigt sich besonders eindrücklich, wenn trockene Fachausdrücke, insbesondere medizinische, auf das pathosgeladene Register des Tragischen treffen. Ein diesbezügliches Beispiel liefert eine Passage aus den Fröschen des Aristophanes, in der Euripides beschreibt, wie er die aufgeblähte Tragödie des Aischylos auf Diät setzt. Aristophanes lässt den Dichter dabei wie einen Arzt sprechen und legt ihm Wortspiele in den Mund, die schwerlich ins Deutsche zu übertragen sind. Niklas Holzbergs Übersetzung bewahrt jedenfalls die bestechend‐komische Wirkung, die von besagten Zeilen ausgeht:
Euripides: Keine Rosshähne, beim Zeus, auch keine Ziegenbockhirsche wie du, wie man sie auf den persischen Wandteppichen abbildet. Nein, als ich erstmals die Kunst von dir übernahm, geradezu aufgedunsen wie sie war von dröhnenden Prahlreden und kaum erträglichen Sprüchen, habe ich sie zuallererst abschwellen lassen und ihr die Schwere genommen durch kleine Verschen, Spaziergänge und weißen Mangold, wozu ich Saft aus Banalitäten reichte, den ich abseihte aus Büchern. Dann habe ich sie mit Monodien aufgefüttert und etwas Kephisophon beigemischt. Schließlich hab ich nicht drauflosgeschwätzt über alles, was mir so in den Sinn kam, noch bin ich einfach in die Handlung hineingestürzt und habe dabei alles miteinander vermengt, sondern derjenige, der zu Beginn auftrat, erzählte sofort die Vorgeschichte meines Dramas. (Arist. Frö. 939–944)
Die ästhetische Strategie, komisches Potenzial aus der Kontrastierung von pathetischem Kolorit und fachsprachlichen Ausdrücken zu gewinnen, durchzieht auch die Tragödienfortschreibungen Jelineks. In Das Werk etwa kollidiert der inflationäre Einschub von Fachtermini aus dem Bereich des Kraftwerkbaus mit Anspielungen auf den Kult des Dionysischen und trägt dadurch dazu bei, die Kommunikation zwischen Heidi und den Peters ad absurdum zu führen:
Heidi: (ist inzwischen längst eingeschlafen, erwacht jetzt wieder, aber nur kurz): O welch ein Wunder, Peter, daß wenigstens das Wasser dich versteht. Denn ich verstehe dich nicht. Kein Wort. Ich habe allerdings auch nur deine letzten Worte mitgekriegt. Das einzige, was ich gern wissen möchte, ist, ob im Damminneren hinter dem Dichtungselement flächenhaft abgeschottet langfristige Erosionssicherung durch Filtern und dieses Dränen stattfindet und welche Kontrolleinrichtungen zur Bestimmung der Druckverhältnisse im Damminneren angebracht wurden […]. Ein flacher Kult, in welchem sich aber das neue Ethos der Sterilität sehr gut ausdrückt, findest du nicht, Peter? (Schläft wieder ein, aber andere Heidis kommen an ihrer Stelle.)
Die Peter: Mir fällt bloß auf, Heidi, daß deiner Aufeinanderfolge von Tatsachen keine adäquaten moralischen und ideologischen Begründungen folgen. […] (WE, S. 119)
Komisches Potenzial hat darüber hinaus der für Jelineks Texte so typische Gebrauch der Personifikation. Das erscheint mir auch deshalb erwähnenswert, weil wir es bei der Personifikation mit einem Phänomen zu tun haben, das urtypisch ist für die Alte Komödie, wo zahlreiche nichthumane, vermenschlichte Sprechinstanzen auftreten, sich zu Chören formieren und den einzelnen Texten zu allem Überfluss auch noch ihren Titel verleihen (Die Vögel, Die Frösche, Die Wespen, Die Wolken etc.). Während derartige be‑lebende dramaturgische Kniffe in den früheren Theatertexten Jelineks noch nicht zum Tragen kommen, setzt sie die Autorin ausgerechnet in jenen Texten, die sich explizit an der griechisch‐antiken Tragödie abarbeiten, intensiv ein. Eindrücklich zeigt sich dies im Theatertext Ein Sturz, wo Wasser und Erde eine tragende Rolle spielen. In einer Anmerkung zum Stück heißt es dazu:
Katastrophen finden meist in sehr großen Räumen statt, damit man sie auch sieht, und Wasser und Erde sind oft beteiligt, auch Beben, das Wasser kommt dorthin, wo es nicht hin soll, die Erde geht, wohin sie nicht soll und umgekehrt. Nichts bleibt an seinem Platz. […] Man teilt Wasser und Erde ihre Rollen zu, in reiner Willkür, aber sie sind damit nicht zufrieden, denn sie wollen übergreifend wirksam werden, und das führt eben zu Übergriffen aufeinander. […] Das Erdfleisch hat sich geöffnet, für wen, für was? Was hat es geschluckt und wofür hat es sich geöffnet, für was? Für neue Bauten?114
Im Stück selbst treten Erde und Wasser tatsächlich in Erscheinung, und zwar in paratragischer Manier im Rückgriff auf Aischylos’ Agamemnon:115
Liebe Erde, bleib, wo du bist, bitte, erwachen könnte Leid über Todesopfer sonst! Wenn anschließend, da du gekommen, wohin du nicht solltest, wirkte schlimme Tat, dann werden wir klagen, dann werden wir nicht klagen, denn wir werden keinen Richter brauchen. Erde, halt! Du hättest vorher anrufen können, meinst du nicht? Das wäre das mindeste gewesen, sich vorher zu melden, bevor du kommst und uns gleich mit Ersticken drohst. Das ist nicht in Ordnung. Sollst uns doch leicht sein, Erde, nicht uns begraben, zumindest jetzt noch nicht, nicht uns ersticken, das ists, was du von einem Weibe, von mir jetzt hörst. (ES, S. 3–4, Herv. SF)
Der hier fett markierte Halbsatz beendet den ersten Absatz des Theatertexts und zitiert wortwörtlich Oskar Werners Übersetzung von Vers 347 des Agamemnon.116 Aufgerufen ist damit eine Szene, in der »[d]ie spannungsgeladene Atmosphäre von Prolog und Parodos […] noch verstärkt wird,«117 wie der Altphilologe Bernd Seidensticker in seinem Kommentar zu Aischylos’ Agamemnon angemerkt hat. Der Wunsch der Klytaimnestra, dass es im Zuge der Eroberung Trojas zu keinen frevelhaften Handlungen seitens des griechischen Heeres kommen möge, kann sich schließlich nicht mehr erfüllen, wie das attische Publikum dank seiner episch‐mythologischen Vorbildung weiß. Die Verbrechen der Eroberer gegen die Götter und Menschen der besiegten Erde verlangen nach Rache.
Jelinek greift die warnenden Worte der Klytaimnestra auf, paraphrasiert sie und bettet sie ein in den Kontext des Einsturzes des Kölner Archivs. Dadurch führt sie den Hochmut des griechischen Heerführers mit der Selbstüberschätzung aktueller, im Dienst des Kapitalismus agierender Politiker*innen eng. So heißt es in Rekursen auf die Verse 339 bis 341, die im Folgenden fett markiert sind:
Hochtief und andre Baukonzerne mit ihren Geräten, schweren Maschinen, mit denen sie dich im Zaum halten sollten, wer, wenn nicht sie, wer, wenn nicht die arge ARGE, aus deren armierten Schädeln die Kinder springen wie aus des Zeus’ Stirne, Subunternehmer sie alle, so viele, Brunnenbauer, Mauerbauer, Erddompteure sie alle, in deinem bezwungenen Land, liebe Erde, ein Land, das du ja bist, nahmen diese Götter Sitz, aber sie konnten nicht sitzenbleiben. Sie standen auf und bohrten und pumpten und bohrten und pumpten. Doch wer über dich siegte, Erde, wird selbst stets aufs neue besiegt. Und da bist du nun! Ist das dein Ernst? So haben sie sich das nicht vorgestellt, denn nur Gier möge vorher noch fallen aufs Heer, zu schänden Heilges, von der Habsucht übermannt! (ES, S. 3., Herv. SF)
In Anlehnung an Klytaimnestra, die die tragischen Auswirkungen von Hybris und Transgression indirekt prophezeit, warnt Jelineks Tragödienfortschreibung vor den Folgen von Raubbau an der Natur. Erde und Wasser werden zu autonom agierenden, mörderischen Elementen, die an die beiden Kontrahenten Agamemnon und Klytaimnestra angeähnelt werden. Wir erinnern uns: Klytaimnestra rächt die von Agamemnon vorgenommene Opferung der gemeinsamen Tochter Iphigenie, indem sie Agamemnon umbringt. Aischylos boykottiert im Gegenüberstellen der beiden transgressiv agierenden Ehegatten eindeutige Schuldzuschreibungen bzw. Schuldlossagungen. Und auch Jelinek bewirkt eine derartige Veruneindeutigung anhand der beiden von ihr ins Spiel gebrachten Elemente Erde und Wasser, die von ihr als Geschädigte wie als Täter*innen vorgeführt werden:
Warte gefälligst, Erde! […] Willst du dir das Wasser vom Leibe halten oder was? Das wär ja, als solltest den Gatten du töten, dein Kind du schlachten, das du so liebst! Was ist hier ohne Schuld? Nichts ist hier ohne Schuld. Das Wasser schon gar nicht. (ES, S. 5, Herv. SF)
Die Verbindung der beiden lebensspendenden und gleichzeitig todbringenden Elemente, die in Köln die Katastrophe ausgelöst hatte, wird hier mit dem Regentenpaar Agamemnon und Klytaimnestra enggeführt und als verhängnisvolle, schuldbeladene Liaison entlarvt, als »verderbliche Liebe« (ES, S. 14), wie es im Theatertext heißt. Im zeitgenössischen Kontext entspricht dabei die unstillbare »Gier des Wassers« (ES, S. 10) den korrupten Machenschaften des Kölner Klüngels.118
Stilfiguren und Tropen
Jelineks Spiel mit unterschiedlichen sprachlichen Registern manifestiert sich in spezifischen rhetorischen Figuren, mit denen auch Aristophanes hantiert. Beide Autor*innen greifen auffällig häufig auf Tropen zurück, die sowohl in der sogenannten Hochkultur als auch in vermeintlich trivialkulturellen Kontexten zum Einsatz kommen. Sie machen inflationären Gebrauch von der Alliteration, die in der Dichtkunst der großen Tragiker eine elementare Rolle spielt und die auch für die Rhetorik der alten Griechen von besonderer Bedeutung ist. Heraklit etwa brachte sein Denken mit folgendem berühmt gewordenen Satz auf den Punkt: Πόλεμος πάντων μέν πατήρ έστι, zu Deutsch: »Der Krieg ist der Vater aller Dinge« (Heraklit: Fragmente B 53). Gleichzeitig beschreibt die Alliteration eine Figur, derer sich die Sprache der Werbung und des Boulevardjournalismus mit großer Vorliebe bedient. Jelineks Gebrauch der Alliteration ruft all diese unterschiedlichen Register auf, wie sich anhand einer Chorpassage aus den Kontrakten des Kaufmanns zeigen lässt:
Sie als Staat haben von uns die Kompetenz bekommen, uns zu komplettieren, äh, hinauszukomplimentieren, äh, nein, uns zu komponieren, äh, zu kontrollieren, genau, das wollte ich sagen! Zu kontrollieren! Das ist das Wort, das uns gefehlt hat, aber sonst fehlt uns nichts, danke.119
Was an dieser Textstelle darüber hinaus ins Auge sticht, ist die klangliche Dimension von Jelineks kalauerndem Gebrauch der Alliteration, die für die Musikerin Jelinek sicherlich von besonderem Belang ist. In einem Interview mit der französischen Übersetzerin und Literaturwissenschafterin Yasmin Hoffmann beschreibt die Autorin ihr poetologisches Vorgehen in Abgrenzung zu jenem ihres geschätzten Schriftstellerkollegen Thomas Bernhard wie folgt:
Ich dagegen arbeite mehr im musikalischen Sinne mit dem Wort selbst, indem ich durch Alliterationen, Assonanzen, Metathese etc. seine Wahrheit heraushole, aus dem Klang des einzelnen Wortes, es ist also ein kompositorisches Verfahren, daß ich die Sprache, auch gegen ihren Willen, zwingen möchte, nur durch sich selbst die Wahrheit preiszugeben. Wenn man will, eben ein kompositorisches Verfahren, während Bernhard eher mit dem Rhythmus arbeitet als mit dem einfachen Wort.120
Die akustische Bedeutung hebt Bernhard Zimmermann auch für die komisch‐poetologischen Verfahren des Aristophanes hervor: »Another, and yet insufficiently explored, aspect of Aristophanes’ language is its acoustic dimension and the use of sound effects and rhetorical figures.«121 Als eindrückliches Beispiel nennt er in diesem Zusammenhang die Alliteration von P‑Lauten, auf die wir im Chor‐Einzugslied in der Komödie Die Ritter stoßen.122
Zwischen Tragödie und Komödie operiert zudem jene rhetorische Figur, mit der Jelinek vielleicht am häufigsten und spielerischsten hantiert – nämlich die Wiederholung. Benannt ist damit das Stilelement zur Erzeugung von Pathos und Gefühlsüberschwang schlechthin. So zählen Anapher, Anadiplose und Polyptoton mit zu den wichtigsten rhetorischen Figuren, die innerhalb von tragischen Klagedarstellungen zum Einsatz gelangen.123 Eindrücklich zeigt sich dies anhand der Troerinnen des Euripides, die Jelinek – wie bereits erwähnt – in Das Werk fortschreibt. Wir haben es dabei mit einer Tragödie zu tun, die durch und durch als Klage konzipiert ist, wie die Altphilologin Ann Suter hervorhebt: »The play is, from both the minute technical, and the overall structural, point of view, a lament.«124 Dieser Klagegestus hallt in Jelineks Fortschreibung Das Werk in der auffällig häufig vorzufindenden Figur der Epizeuxis nach, d.h. in der dreimalig aufeinanderfolgenden Wiederholung einzelner Lexeme: »Wir müssen von unserem Heim immer mehr zurückkriegen, als wir ihm gegeben haben, und zwar Gemütlichkeit, Gemütlichkeit, Gemütlichkeit« (WE, S. 148–149, Herv. SF), »Das Meer spult sein Maßband ab, und dann spult es seine ewig gleiche Nummer ab, Wasser, Wasser, Wasser […]« (WE, S. 163, Herv. SF). Eine ähnlich eindringliche Wirkung erzielt Jelineks Einsatz der Anapher: »Bitte entschuldigen Sie die Schilderung, bitte beschildern Sie Ihre Schulden, damit wir wissen, wieviel es ist, bitte verschwenden Sie keinen Gedanken, Sie haben keinen zu verschwenden […]« (WE, S. 150, Herv. SF).
Wie unschwer zu erkennen ist, kreieren die Figuren der Ripititio innerhalb der zitierten Passagen aber nicht ausschließlich Eindringlichkeit und/oder Pathos. Die Wiederholungen sind darüber hinaus unmittelbar an der Herstellung der Komik beteiligt, die von den jeweiligen Textstellen ausgeht. Illustrieren lässt sich dies abermals anhand einer Passage aus dem Epilog in Das Werk:
[…] dieses Kommen der Mütter also, die alle nicht mehr dazu gekommen sind, ihre Söhne zu ficken, es kommt nicht aus der Zukunft und nicht aus der Vergangenheit, sondern: es macht die Vergangenheit und die Zukunft, was hat dieses Kommen denn da wieder angerichtet, es ist nicht zu glauben, da kommen sie und wollen nach so langer Zeit, die wir noch mühsam weiter in die Länge gezogen haben, ein Geld von uns! (WE, S. 240, Herv. SF)
Der Begriff »kommen« rekurriert hier in Form eines Polyptoton und weckt dabei derbe sexuelle Assoziationen. Ähnlich verfährt Jelinek in Ein Sturz, wo die Phrase »wir kommen« (ES, S. 2) allein auf der ersten Manuskriptseite sechs Mal wiederkehrt und auf der darauffolgenden Seite von vier Wiederholungen der Sequenz »sie sind gekommen« (ES, S. 3) abgelöst wird. In beiden Fällen, also sowohl in der Passage aus Das Werk als auch in jener aus Ein Sturz, haben wir es mit einem paratragischen Einsatz der Ripititio zu tun. Einerseits lassen sich die zitierten Wiederholungen als Kalauer lesen, als platte Witze mithin, von denen die Alte Komödie überquillt125 und die Jelinek so gerne einsetzt (»Ich liebe den Kalauer und werde ihn niemals, niemals aufgeben! Kalauer sind die Augenblicke der Wahrheit. Wenn man lange genug auf die Sprache einprügelt, gibt sie, manchmal widerwillig, aber doch, ihre eigene Wahrheit preis, und zwar eine Wahrheit, die ihr selber innewohnt, zu innerst wohnt«126).127 Andererseits aber zitieren die unterschiedlichen Temporalformen, in denen das Verb »kommen« auftritt, ein dramaturgisches Charakteristikum der tragischen Klage: nämlich die kontrastierende Gegenüberstellung von Gegenwart und Vergangenheit, auf die wir auch in den Troerinnen treffen.128
Optimal zur Geltung gelangt diese Janushäuptigkeit erst im Sprechen selbst. Die tragikomische Wirkung von Jelineks Texten entfaltet sich in der (aussprechenden) Stimme bzw. im (vernehmenden) Ohr. Sie ist an eine spezifische Körperlichkeit geknüpft, die auch der Regisseur Nicolas Stemann regelmäßig hervorhebt. In einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung etwa bemerkte er: »Diese Sprache will gesprochen werden. Eine Art lautes Denken, das die Sprechenden oft überholt, sie in eine andere Richtung drängt, als sie es beabsichtigt hatten. Sie wollen ihre Unschuld beteuern und zeigen über ihr Sprechen ihre schuldhafte Verstricktheit. Das ist tragisch und komisch.«129 Die Wiederholungen innerhalb von Jelineks Theatertexten fungieren in diesem Kontext gewissermaßen als Scharniere. Sie wirken kohärenzbildend, indem sie unterschiedliche, mitunter äußerst heterogene Diskurse und Themen zu zusammengehörigen Sequenzen verschalten. Darüber hinaus dienen sie aber auch als Verbindungsglieder zwischen »hohem« und »niederem« Register, die Jelinek virtuos ineinanderschraubt, um dadurch – wie Ulrike Haß so treffend bemerkt hat – die Sprache zu brechen.
6.2.4 Autoreferenzialität und Metatheatralität
In welchem Dienst aber steht die ästhetische Praxis der Intertextualität, auf die Jelinek im besagten Bestreben, die Sprache zu brechen, zurückgreift? Worauf zielt ihre Aneignung, Übermalung und (De‑)Montage von kanonisierten Texten? In welchem Kontext steht dieses Recycling zu der Arbeitsweise des Aristophanes? Und welche Rolle spielt bei all dem das Theater?
Folgt man der Literaturwissenschafterin Anne Fleig, so hebt die Bezugnahme auf die »Klassiker« Jelineks Anspruch auf ein eigenes, autonomes Werk hervor.130 Das damit in Zusammenhang stehende Verfahren bezeichnet Fleig als »zitierte Autorität« und verweist dabei auf die beiden Bedeutungen des Verbs »zitieren«: Einerseits ist damit das Wiedergeben einer bestimmten Textpassage benannt, andererseits bedeutet es, jemanden herbeizurufen, eine Person zur Rechenschaft zu ziehen. Zitierte Autorität beschreibt den intertextuellen Rückgriff auf andere Texte, wobei das eigene Sprechen durch das Berufen auf andere verstärkt wird. Gleichzeitig, so Fleig, erweise sich diese Strategie bei Jelinek als »subversive Anmaßung männlicher Autorität […] und impliziert dadurch zweierlei: Zitierte Autorität bedeutet hier einerseits die Vermehrung von Autorität durch intertextuelle Stimmenvielfalt und andererseits die Infragestellung auktorialer Autorität im Sinne schöpferischer Originalität.«131
Auch in der Alten Komödie treffen wir auf eine spezifische Form zitierter Autorschaft. Aristophanes lässt die Tragiker Aischylos, Sophokles und Euripides in seinen Texten als Figuren auftreten und spricht ihnen dadurch eine bestimmte Autorität zu, die im Kontext des kulturellen Lebens der attischen polis auch identitätsstiftend fungiert. Dass die Art und Weise, auf die er seine Kollegen vorführt, keine schmeichelhafte ist, tut der Huldigung, die die Dichter und mit ihnen auch das Genre der Tragödie dadurch erfahren, keinen Abbruch. Eindrücklich zeigt sich dies etwa in den Fröschen, wie Johanna Hanink betont: »[…] Frogs does mark a complex comic statement of appreciation for tragedy; it also proposes one provocative articulation of the civic functions of both dramatic genres: Athens needed good tragedians to guide it, but it also needed incisive comedians who would ensure that audiences applied a critical lens to what they saw and heard on the tragic stage.«132
Aristophanes bietet aber nicht nur seinen Dichterkollegen eine Bühne. Er schreibt sich auch selbst als Sprechinstanz in seine eigenen Texte ein und reflektiert in dieser Form coram publico poetologische Fragen bzw. das von ihm strapazierte Genre. In der Tragödie wäre so etwas schlicht nicht denkbar. Tatsächlich betont Oliver Taplin in seinem Plädoyer für eine strikte Trennung von Tragödie und Komödie, dass autoreferenzielle Bezüge ein exklusives Charakteristikum der Komödie darstellen: »The poietes of Old Comedy may refer to himself, and to his own activity of producing comedy. […] This simply does not happen in tragedy.«133 Es sei nicht einmal zulässig, so Taplin weiter, in bestimmten Figurenaussagen die Stimme des Autors zu identifizieren (wie es Wilamowitz etwa in Bezug auf die Zeilen Herakles 637ff. vorgeschlagen hat).134 Wie aber spricht Aristophanes aus dem Text? Welche Strategie wendet der Autor dabei an?
Die Antwort auf diese Frage bringt ein weiteres dramaturgisches Merkmal der Komödie zum Vorschein, das wir in der Tragödie nicht anfinden – nämlich die Parabase. Die Parabase diente dazu, die Zusehenden direkt anzusprechen, und bot dem Komiker eine beispiellose Gelegenheit, das Publikum durch die Maske des Chors mit persönlichen Überzeugungen, Urteilen oder Vorwürfen zu konfrontieren. In der ersten Parabase der Wespen beispielsweise tritt der Chor aus seiner ursprünglichen Rolle heraus und wirft dem Publikum vor, Aristophanes in der Vergangenheit schlecht behandelt zu haben. Der Chorführer setzt wie folgt an:
Chf.: Und jetzt Leute, passt auf, wenn ihr Klarheit liebt!
Denn der Dichter möchte jetzt gern die Zuschauer tadeln.
Denn er habe Unrecht erfahren, sagt er, obwohl er zuvor ihnen viel
Gutes erwiesen hat,
zunächst nicht offen, sondern versteckt in Unterstützung anderer Dichter,
indem er Weissagekunst und Denken des Eurykles nachahmte
und in die Bäuche andere eintauchte und so viel Komisches
ausschüttete,
danach aber auch schon offen und auf eigenes Risiko,
indem er nicht fremde, sondern eigene Musen am Zügel führte.135
Aristophanes instrumentalisiert hier mithin den Chor, um dem eigenen Missmut ob seines Eindrucks, als Dichter verkannt worden zu sein, Luft zu machen. Der Chorführer scheint mithin als Sprachrohr der Frustration des Autors zu fungieren.
Ganz ähnlich verfährt Jelinek in ihren Theatertexten, aus denen – besonders in den letzten Jahren – eine spezifische Resignation spricht. Besonders deutlich zeigt sich das anhand ihres 2011 entstandenen Theatertexts Winterreise. Dort ertönt eine Ich‐Instanz, die im Rückgriff auf die Figur des Leiermanns aus Wilhelm Müllers und Franz Schuberts Liederzyklus die mangelnde Resonanz auf das eigene (politische) Schreiben bedauert:
So, da steh ich also mit meiner alten Leier, immer der gleichen. Wer will dergleichen hören? Niemand. Immer dieselbe Leier, aber das Lied ist doch nicht immer dasselbe! Ich schwöre, es ist immer ein anderes, auch wenn es sich nicht so anhört, wenn es sich manchmal mit anderen Liedern überschneidet, man kann meins immer noch heraushören, auch wenn die Pistenlautsprecher toben, kann man mein Lied noch hören, oder?136
Das Nicht‐gehört‐Werden, das das unbenannte Ich hier beklagt, korrespondiert mit dem musikalischen Charakter des Liedes Der Leiermann, das den Liederzyklus Die Winterreise beschließt. Dort identifiziert sich das lyrische Ich mit dem »wunderlichen Alten« am Rande des Dorfes, dessen beständiges Leierspiel der Gesellschaft lästig ist (»Keiner mag ihn hören/Keiner sieht ihn an; Und die Hunde knurren/Um den alten Mann«). Das Lied endet offen auf der Akkordquinte und mündet dadurch in einer eigentümlichen Leere, die bei den Hörer*innen auch nach dem Erklingen des letzten Tons nachwirkt. Auf diese Weise verleiht Schubert der Verzweiflung des Wanderers, der sich von der Welt völlig unverstanden und abgelehnt wähnt, maximalen Ausdruck. Wenig beforscht ist die These, wonach sich darin Ausdruck einer politischen Desillusionierung von Schubert zeigt, der über das seit dem Wiener Kongress (1814/15) bzw. den Karlsbader Beschlüssen (1819) ruhiggestellte Volk äußerst verzagt war.137 Tatsächlich ist es das Empfinden einer solchen politischen Ausweglosigkeit, das in Jelineks Winterreise erfahrbar wird, wenn es etwa im Rückbezug auf die Lieder Das Wirtshaus und Der Leiermann heißt: »Ich möchte so gern noch leben! Alle übertönen mich, nicht nur die Pistenlautsprecher, inzwischen übertönen sogar leise Gespräche an Wirtshaustischen, an denen ich keinen Stammplatz habe, meine Leiern, mein endloses Geseiere, mein Geleiere.«138
Autoreferenzielle Bezüge findet man aber bereits viel früher in Jelineks (post‑)dramatischem Werk vor, nämlich in Ein Sportstück, wo unter den Sprechenden sowohl »Elfi Elektra« zu finden ist als auch »die Autorin«, die sich »von Elfi Elektra vertreten lassen [kann]« (SP, S. 184). Mit der tragischen Figur der Elektra zitiert Jelinek »die erste weibliche Individualisierung auf dem Theater,«139 wie es bei Einar Schleef heißt. Schleef zufolge wird Elektra »von einer übermächtigen Bindung an die untergegangenen Figuren erdrückt, die ihr Denken, ihre weibliche Energie, ihre Inanspruchnahme männlicher Hilfeleistung bestrafen. Für Elektra zählt kein Jetzt, nur ein Damals, das ein VOR DEM PALAST ist.«140 Bei Sophokles beschreibt dieses VOR DEM PALAST die Weigerung der Elektra, innerhalb des zentralen Konflikts zu agieren. Sie verharrt vor dem Palast und wartet dort auf ihren Bruder Orest, der ihre Rachepläne in die Tat umsetzen und die Mutter bzw. die Mörderin des Vaters töten soll. Vor diesem Hintergrund kann Elektra mit Schleef als »Gründungsfigur des antiken, tragischen Proszeniums«141 gelesen werden, wie Christina Schmidt eindrücklich gezeigt hat.
Im Gegensatz dazu geht von Jelineks schizophrener Elfi Elektra, die zwischen unterschiedlichen Figuren changiert, zusätzlich etwas durch und durch Komisches aus. Dies zeigt sich mitunter, wenn Elfi Elektra das parasitäre, zitierende Verfahren, aus dem sich ihr eigenes Sprechen herausbildet und dem Ein Sportstück zugrunde liegt, als diebisch bezeichnet (»Meine Versionen habe ich mir angelesen wie ein Dieb.« (SP, S. 10)). In diesem Mäandern zwischen tragischer Figuration, autoreferenziellem Zitat und Parodie kann Elfi Elektra als paratragische Figuration par excellence gelesen werden.
Sicht‐ und greifbar wurde die Einschreibung der Autorin in Schleefs Uraufführung von Ein Sportstück. Schleef ließ den gesamten Schlussmonolog der Autorin auf ein riesiges Bodentuch drucken, das er selbst – den Text sprechend – beschritt. In der dritten Aufführung betrat dann Jelinek die Bühne und reklamierte sich mit ihrer Erscheinung und ihrer stimmlichen Präsenz in die Inszenierung hinein. In der siebenstündigen Langfassung wiederum spazierten beide »durch« den Text.142 Worauf aber verweist dieses metatheatrale Spiel?
Ulrike Haß hält diesbezüglich fest: »Die Einschreibung der ›Autorin‹ zwischen die vielfältigen Sprechinstanzen, deren Ich und Wir die gespenstischen Populationen der Rede skandieren, geht über das Spiel mit der Fiktionalisierung der Autor‐Adresse hinaus.«143 Haß betont die Unterwerfung unter eine Entäußerung, die mit einer solchen Einschreibung in Mitteilungen, die auf der Bühne zur Sprache gebracht werden, einhergeht. »Die Kom‐Positionierung der Autorin‐Instanz zwischen oder in den Sprechakten auf der Bühne teilt deren Bewegung des Auswendigwerdens als Verausgabung.«144 Besonders interessant aber erscheint mir der Umstand, dass die Einschreibung der Autorin in Ein Sportstück mit vielerlei autopoetischen Kommentaren bzw. mit Reflexionen über das eigene Schreibverfahren verbunden ist, also mit einer typischen Eigenheit der aristophanischen Komödie, die wir als solche in der Tragödie nicht vorfinden. So treffen wir in Ein Sportstück auf eine Textstelle, in der die (weibliche) Autorschaft von Elfi Elektra als Täterschaft vorgeführt wird, und zwar im Rückgriff auf die aus Rache mordende Elektra:
Mein Papa ist ein König gewesen und so elend gestorben. Dabei sollte er speerbezwungen unter meinem Schreibtisch ruhen anstatt daß ich, seine Mörderin, hier sitze und auf die Tasten dresche, daß das Blut mir unter den Nägeln herausspritzt. Immerhin, ein Stück Korn habe ich dabei gefunden. (SP, S. 173)
Als ähnlich dominant erweist sich die Autoreferenzialität in Das Werk, wo sich eine Ich‐Instanz wortwörtlich einschaltet: »Ich schalte mich ein, hoffe, einer schaltet mich wieder aus, man soll schließlich Strom sparen« (WE, S. 169). Im Gegensatz zu Ein Sportstück aber kommt es hier zu einem direkten Dialog zwischen Sprecher und Autorin: »Ach was, nein, vergessen, ich bin doch längst weg. Was rede ich da und rede und rede noch, wenn ich doch längst weg bin. Autorin, also wirklich! Lassen Sie mich endlich still sein und seien Sie endlich selber still! Wenn Sie nicht still sein können, kann auch ich es nicht« (WE, S. 233).145
Das Spiel mit dem polysemantischen Begriffspaar weg/Weg begegnet bereits in der Nachbemerkung zu Macht nichts. Eine kleine Tragödie des Todes (1999), wo es heißt: »Die Autorin ist weg. Sie ist nicht der Weg.«146 Auch in der Nobelpreisrede Im Abseits greift Jelinek dieses Wortspiel wieder auf: »Was immer geschieht, nur die Sprache geht von mir weg, ich selbst, ich bleibe weg. Die Sprache geht. Ich bleibe, aber weg. Nicht auf dem Weg. Und mir bleibt die Sprache weg.«147 Während Jelinek hier, wie die Literaturwissenschafterin Rita Svandrlik angemerkt hat, »im bewegend gefühlvollen Register« eine Haltung inszeniert, die man als »schwache Autorschaft« bezeichnen könnte,148 bestechen die autopoetischen Einschübe in Das Werk vielmehr durch ihre beißende Selbstironie sowie durch eine bestimmte Leichtigkeit. Verdeutlichen möchte ich dies anhand von drei Beispielen:149
Ja, menschliches Leid kann natürlich niemals mit Geld aufgewertet werden, das sage ich einmal so ohne Zusammenhang, aber es paßt an jeder andren Stelle auch hin. Den Satz behalte ich, den kann ich auch noch öfter verwenden. (WE, S. 94)
Das Nichts brauchen wir dazu nicht, das können wir leicht selber erzeugen, aber jetzt brauchen wir einmal das Gefälle, das einen recht gefälligen Eindruck machen wird, da bin ich sicher, wenns nur erst mal da ist, haha. (WE, S. 172)
Das Denken ist Ihr Eigentum, und seine Eignung entspringt aus der Enteignung!, nein, Moment, es entspringt aus der Ereignung, sehe ich gerade, bin beim Abschreiben in die falsche Zeile gerutscht, entschuldigen Sie, […]. (WE, S. 176)
Jelineks In‑Szene‐Setzung der eigenen Autorinnenposition impliziert ein Spielangebot, das von Regisseur*innen und Schauspielenden dankbar und auf äußerst unterschiedliche Weise genutzt wird. So ist die Anzahl der Inszenierungen, die darauf in Form von Jelinek‐Perücken, ‑Puppen oder ‑Masken reagieren, mittlerweile beinahe unüberschaubar. Den Beginn dieses Trends markiert Frank Castorfs Inszenierung von Raststätte oder: Sie machens alle. Eine Komödie am Schauspielhaus Hamburg 1995, in der Jelinek als übergroße Sexpuppe auf die Bühne gebracht wurde. Wenngleich Castorfs respektloser Umgang mit Jelinek »den Weg zur Behandlung der Texte als reine Spielvorlage [bahnte],«150 so war die Autorin an dieser Entwicklung nicht ganz unbeteiligt. Sie reagierte postwendend auf Castorfs szenografische Entscheidung, indem sie ihrem Sportstück folgende berühmt gewordene Regiebemerkung voranstellte: »Die Autorin gibt nicht viele Anweisungen, das hat sie inzwischen gelernt. Machen Sie, was Sie wollen« (SP, S. 7). Im Rekurs auf Castorfs Inszenierung der Autorinneninstanz kommuniziert der Text also auf affirmative Weise mit dem Theater und stößt somit einen intermedialen Transfer an, innerhalb dessen die Autorin auf paradoxe Weise an‐ und gleichzeitig abwesend ist.
Heute gibt es kaum eine Jelinek‐Inszenierung, die nicht produktiv mit der Einschreibung der Autorinneninstanz umgeht und Jelinek auf die eine oder andere Art »auftreten« lässt. In diesem Spiel werden, so die Literaturwissenschafterinnen Delphine Klein und Aline Vennemann, »körperliche und stimmliche Attribute der Autorin nicht nur zu Projektionsflächen neuer und alter Diskurse, sondern wie Marionettentheater, sprich traditionsgemäß, als diskursive, diskurskritische Interface [sic!] inszeniert und reflektiert.«151 Für die österreichische Erstaufführung von Schatten (Eurydike sagt) am Wiener Akademietheater etwa verwendete Regisseur Matthias Hartmann Masken und Perücken, wodurch sieben Schauspielerinnen Jelinek auf schaurige Art ähnlich sahen. Darüber hinaus beauftragte Hartmann den Puppenbauer und ‑spieler Nikolaus Habjan mit der Anfertigung einer lebensgroßen Jelinek‐Büste. Die Übernahme der Autorinnenstimme durch die Puppe und seinen Spieler vollzog, so Klein und Vennemann, »durch synekdotische Verdoppelung der Autorinnenfigur die auktoriale Autorität […].«152 Auch in Schatten verknüpft Jelinek das Wort der (fiktiven) Autorin mit einer antiken mythologischen Figur. Hier ist es Eurydike, der durch das bewährte herbeizitierende Verfahren eine Stimme verliehen wird, wie bereits aus dem Beginn des Textes hervorgeht:
Ich weiß nicht, was gleitet da an mir herunter, nein, es scheint eher von unten zu kommen und sich hinaufzuarbeiten, hat es jetzt die Ferse schon erreicht, das Knie? […] Da rinnt etwas, vielleicht werde ich nicht mehr am Herd und nicht mehr an meinem frisch angefangenen Manuskript arbeiten können, das vorhin noch so glatt aus mir hervorgekommen ist. Ja. Vielleicht ging alles zu glatt. Mein Schreiben, das rinnt wohl auch, so empfinde ich es, wissen Sie, mein Mann hingegen singt. Auf seinem eigenen Soundtrack eilt er dahin. Das hat ihn berühmt gemacht. Bevor er zu singen begonnen hat, war die Stille etwas Großes, etwas Heiliges, jetzt gibt es sie nicht mehr, mit seiner Stimme hat er die Stille durchdrungen und sie vernichtet. Ich bin stiller geblieben. Ich schreibe, wen interessierts.153
Das Thema der weiblichen Autorschaft wird hier von Eurydike, der im Mythos eine durch und durch passive, stumme Rolle zukommt, zur Sprache gebracht. Eurydike ist dabei, wie die Literaturwissenschafterin Inge Stephan unterstreicht, »als mythische Figur und als Schatten des Mannes in doppelter Weise überdeterminiert.«154 Der in der zitierten Passage fett markierte letzte Satz kann als Kommentar zu Michel Foucaults viel zitiertem Diktum »Wen kümmert’s, wer spricht« gewertet werden.155 Darüber hinaus lässt er einmal mehr an Aristophanes’ dramaturgisches Verfahren denken, sich in Form einer Figur in den Text hineinzureklamieren und so der eigenen Frustration ob des Unverständnisses des Publikums Ausdruck zu verleihen. Vor diesem Hintergrund kann man aus der im Folgenden zitierten Passage nicht nur, wie Stephan meint, »Angriffslust, Wut, Trauer, Melancholie, Depression und Todessehnsucht«156 heraushören. Liest man sie als selbstironische Reflexion des schriftstellerischen Produktions‐ und Rezeptionsprozesses, so wirkt sie durchaus (auch) komisch:
[…] ich habe keine Werke, ich werde nie Werke haben, wie schön!, keine Werke mehr, versprochen!, ich hatte ja nie welche und werde keine mehr haben, niemand sieht meine Werke, niemand hat sie je gesehen, sie sind nichts, sie sind Dreck, mein Werk ist Dreck, und ich bin das Dunkel dazu, das über sie wacht, über die Werke im Dunkel wacht, das Nichts wacht über den Dreck, und ich bin das dazugehörige, dazu passende Dunkel, umstanden von noch mehr finsterem Schattengebäu.157

Abbildung 17: Elfriede Jelinek: Schatten (Eurydike sagt). Regie: Matthias Hartmann. Burgtheater Wien 2013. Foto: Roland Schlager/APA/picturedesk.com.
Habjans Jelinek‐Puppe, die in Hartmanns Schatten‐Inszenierung die Instanz der Autorin verkörpert, trat auch bei der Nestroy‐Verleihung 2013, als Jelinek den Autor*innenpreis erhielt, prominent in Erscheinung. Sie nahm die Auszeichnung stellvertretend für die Autorin entgegen und übermittelte dem Publikum die vorab von Jelinek aufgenommene Preisrede.158 Sechs Jahre später kehrte sie in der österreichischen Erstaufführung von Am Königsweg am Landestheater Niederösterreich in St. Pölten (2019) wieder, in der Habjan selbst Regie führte. Auch dort übernahm sie den Part der Ich‐Instanz, die gemeinhin als Stimme der Autorin aufgefasst, als solche jedoch im Text niemals deklariert wird. Mit Katharina Pewny kann das belebte Objekt der Jelinek‐Puppe mithin als Travelling Icon bezeichnet werden, d.h. als eines der vielen Motive und Objekte, »die durch die unterschiedlichen Ausdrucksformen von Jelinek und rund um sie reisen.«159 Tatsächlich stellt Habjans Handpuppe nicht nur Verknüpfungen zwischen unterschiedlichen Jelinek‐Inszenierungen her, sondern vernetzt auch unterschiedliche Medien und Textsorten (wie etwa Theatertext und Preisrede) miteinander. Ähnlich verhält es sich mit der unverkennbaren Jelinek‐Perücke, die seit Nicolas Stemanns Uraufführung von Das Werk am Wiener Burgtheater (2006) gewissermaßen von Inszenierung zu Inszenierung reist und dabei mit unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen wird.

Abbildung 18: Elfriede Jelinek: Am Königsweg. Regie: Nikolaus Habjan. Landestheater Niederösterreich, St. Pölten 2019. Foto: Alexi Pelekanos.
Als Travelling Icon kann auch das Tier‐ bzw. Plüschkostüm aufgefasst werden, das Jelinek in unterschiedlichen Theatertexten ins Spiel bringt. In Zusammenhang mit dezidiert autoreferenziellen Bezügen begegnet es in Das schweigende Mädchen, wo der abschließende Sprechtext der Autorinneninstanz durch folgende Regieanweisung (übrigens die einzig fettgedruckte innerhalb des Textes) eingeleitet wird:
Ich (ganz in Plüsch, aber das Fell halb heruntergezogen. Eine Hyäne wär ich gern, Totes wegputzen, ich glaube, das würde mir liegen):160
Tatsächlich bezieht sich der Großteil der Regieangaben, die wir in diesem Theatertext vorfinden, auf die Kleidung der Sprechinstanzen, die zwischen Tier und Mensch, Tier und Gott, Autorin und Autorinnenfigur changieren. Dem An‐ und Ausziehen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Für die Plüschtiere etwa sieht der Text vor, dass sie »[…] langsam ihre Kostüme aus[ziehen], abwechselnd, verschiedene Stadien des Aus‐ und Angezogenseins.«161 Besonders ins Auge sticht in diesem Zusammenhang die Ich‐Instanz. Sie spricht innerhalb der Regieanweisungen selbst, schreibt sich also tatsächlich selbstreferenziell in den Text ein:
Ich:
(schäle mich auch aus meinem Kostüm, endlich! Mir war schon ordentlich heiß)162
Die intensive Auseinandersetzung mit dem Kostüm markiert eine metatheatrale Signalsetzung, die für die Alte Komödie symptomatisch sei, wie Oliver Taplin betont: »[…] in Old Comedy there is much play with costume, with putting it on and taking it off on‑stage; and especially with the failure of disguise, since this comically shakes the whole undertaking, and threatens to return the actors to the world of the audience.«163 Nun würde die analog zu Taplin aufgestellte Behauptung, dass Jelineks Ausstellen des Kostüms eine Rückkehr der Schauspielenden in die Welt des Publikums bewirke, freilich dem eigentümlichen Impetus ihrer Texte widersprechen. Die Parallele scheint mir vielmehr darin zu liegen, dass beide ästhetische Verfahren theatrale Kategorien wie Illusion und Fiktion im Hervorheben des Kostüms entschieden aushebeln und gleichzeitig die spezifische Wirklichkeit des Mediums Theater hervorkehren. Dies unterscheidet Aristophanes und Jelinek radikal von den antiken Tragikern, die äußerst vorsichtig mit dem Einsatz von Verkleidungen umgingen bzw. keinerlei Umzüge on stage vorsahen. Eine diesbezügliche Ausnahme bildet Euripides, dessen Bezug auf die Verwandlung induzierende Kleidung vor allem in den Bakchen durchaus metatheatrale Züge annimmt. Und dennoch besteht auch dort ein wesentlicher Unterschied zu Aristophanes, wie die Altphilologin Frances Muecke demonstriert: »[…] in Euripides, play with the theatrical illusion is for the sake of the play with ideas in the drama, while in Aristophanes contrast between reality and illusion is used for the sake of reflecting upon theatrical illusion itself.«164 Im Gegensatz zu Euripides stehen Aristophanes und Jelinek für ein anti‐illusionistisches Theater, das den Schauspieler*innenkörper als solchen ausstellt und ihn mithilfe von Kostümen, Masken und anderen props grotesk verzerrt und erweitert.
6.2.5 Groteske Körperlichkeit
Wenngleich sich Jelinek bzw. die von ihr installierte Autorinneninstanz bekanntlich großzügig zeigt, was die inszenatorische Realisierung ihrer Texte angeht (»Machen Sie, was Sie wollen«), so findet man in vielen ihrer für das Theater verfassten Arbeiten sehr konkrete Inszenierungswünsche vor. Zeigen lässt sich das etwa anhand ihres 2009 entstandenen Theatertexts Abraumhalde, in dem Jelinek Lessings Nathan der Weise mit der sophokleischen Antigone verknüpft. In der Passage, die dem Sprechtext vorangestellt ist, heißt es:
Wie immer habe ich die Ästhetik der Aktionen von Paul McCarthy im Auge und nicht nur dort. »Bunker Basement« oder »Piccadilly Circus« wären Beispiele dafür, was ich meine. […] Falls man es inszenieren möchte: Die Figuren, die sprechen, sollen entweder durch riesige Pappmachéköpfe, die sie tragen, am besten mit dem Gesicht nach hinten, sodaß sie auf der Bühne dauernd zusammenstoßen, umfallen, das Bühnenbild, falls es eines gibt, umreißen, die Bühne auf unterschiedlichste Weise devastieren etc. etc. Oder die Figuren verdoppeln sich auf andere Weise. Sie tragen Kopf und Glieder, sozusagen ein zweites Mal, eben verdoppelt, mit sich herum. Der Kopf soll dann ihre Gesichtszüge tragen, er kann aber auch andre haben. Es soll eine Vermehrung und/oder eine Vergrößerung von allem stattfinden. Vielleicht, wenn sich Gegenstände auf der Bühne befinden, sollen die proportional sehr klein sein, damit die Figuren riesig wirken.165
Die grotesken Verfahren der Verzerrung, die Jelinek hier benennt bzw. präinszeniert, zitieren nicht nur die von der Autorin genannte Ästhetik des US‑amerikanischen bildenden Künstlers Paul McCarthy. Sie liefern darüber hinaus ein weiteres bedeutendes Indiz dafür, dass Jelineks Theater tief in der antiken Tradition der Alten Komödie verwurzelt ist, und lassen unmittelbare Assoziationen zur Aufführungspraxis dieses Genres zu. Dies zeigt sich insbesondere im Hinblick auf die Maske. Wie ich bereits weiter oben ausgeführt habe, orientierte sich die tragische Maske in ihrer physiognomischen Ausgestaltung am ästhetischen Ideal der Zeit. Die komische Maske (geloios) wiederum unterschied sich durch ihren spezifischen Anti‐Illusionismus.
Offensichtlich wird dies anhand einer Vase des Malibu‐Malers, auf der eine komische Szene zwischen drei Schauspielern abgebildet ist, die vom Auftritt eines tragischen Schauspielers unterbrochen wird.166 Die Überraschung steht den beiden Choregen buchstäblich ins Gesicht geschrieben, während der als Pyrrhias titulierte Schauspieler in seiner für die Komödie charakteristischen großen Geste regungslos verharrt. Alle drei verfügen über typische Attribute der Komödie, d.h. einen vorstehenden Bart, gepolsterte Gesäße und Bäuche sowie übergroße Phalli. Im Gegensatz dazu ist der tragische Schauspieler nicht offensichtlich maskiert. Seine ernsten Gesichtszüge entsprechen den Darstellungen »seriöser« Charaktere, die wir auf zeitgenössischen Vasenmalereien vorfinden, und reproduzieren als solche das auf vielen Exponaten vorzufindende Ideal des männlich‐autochthonen Griechen.
Die komische Maske invertiert dieses Ideal in grotesker Manier. Wie auf der abgebildeten Vase zu sehen ist, verfügt die komische Maske charakteristischerweise über eine flache Nase, hervorquellende Augen, hohe Brauen und einen überdimensional großen, klaffenden Mund. Der Ausdruck von sophrosyne (Tugendhaftigkeit), der sich in den ernst(haft)en Gesichtszügen der tragischen Maske manifestiert, wird in ihrem komischen Gegenstück burlesk verkehrt. Diese Verkehrung darf freilich nicht losgelöst von der damit einhergehenden Reproduktion spezifischer pejorativer Humandifferenzierungen betrachtet werden. Tatsächlich scheint sich die komische Maske an den »extraordinary bodies«167 gesellschaftlich stigmatisierter Menschen zu orientieren, wie Alan Hughes festhält: »Such men were kukus, physically and morally inferior. Their untended bodies and public privates implied a lack of self‐respect.«168

Abbildung 19: Rotfiguriger Volutenkrater (Choregosvase). Malibu‐Maler. Detail. Um 400 v. Chr. Foto: J. Paul Getty Museum Malibu.
Dennoch werden Distinktionen innerhalb der Alten Komödie grundsätzlich gestört. Im Gegensatz zur Neuen Komödie, die als dualistisch beschrieben werden kann,169 handelt es sich bei der Alten Komödie um eine durch und durch holistische Kunstgattung, die Unterschiede jeglicher Art verkehrt oder tilgt, wie David Wiles unterstreicht:
[G]ods interacted with mortals, slaves are confused with masters, actors flowed in and out of the choral group, use of the orchestral space helped incorporate the audience in the fictional world of the play, and there was little by way of a neck to dissociate head/mask from body. Stomach and phallus were a reminder of animal impulses driving the integrated human organism.170
Abbildungen von komischen Szenen, die wir auf süditalienischen Vasen vorfinden, lassen autochthone griechische Jünglinge in der Komödie keineswegs »besser« aussehen als ihre Väter oder als Versklavte. Auch sie waren mit Attributen ausgestattet, »that express their inferiority as clearly as their padded costume and exposed phallos«, wie Alan Hughes unterstreicht.171 Aus der Zusammenschau von Maske und Kostüm ergibt sich, dass der komische Schauspieler dem Ideal des freien, männlichen Bürgers ein Zuviel bzw. ein Zu groß entgegensetzt, das sich in der ausgestopften Bauch‐ und Gesäßregion, im übergroßen Mund, im langen, abstehenden Bart, den langen, spitzen Ohren und nicht zuletzt im riesigen ledernen Phallus, der an das Kostüm angenäht war, zeigt.
Vor diesem Hintergrund scheint es mir hervorhebenswert, dass auch Jelinek konsequent an einer Ästhetik der Deformation arbeitet, wie bereits aus ihrem frühen Theateressay Ich schlage sozusagen mit der Axt drein (1984) abzulesen ist: »Wenn ich Theaterstücke schreibe, dann bemühe ich mich nicht, psychologisch agierende Personen auf die Bühne zu stellen. […] Ich vergrößere (oder reduziere) meine Figuren ins Übermenschliche, ich mache also Popanze aus ihnen, sie müssen ja auf einer Art Podest bestehen.«172 Wie Peter Fuß herausgestellt hat, sind Vergrößerung und Verkleinerung die einfachsten Formen grotesker Verzerrung, »sie verändern die Struktur ihres Objekts kaum, vergrößern oder verkleinern nur die Abstände zwischen den Punkten des Abbilds in Relation zu den entsprechenden Punkten des Modells.«173
Daraus ergeben sich Spielangebote, die von Theatermachenden gerne genutzt werden. Nicolas Stemann beispielsweise setzte für die Uraufführung von Abraumhalde Jelineks Wunsch nach riesigen Pappmachéköpfen tatsächlich in die Tat um und versah diese u.a. mit den Gesichtszügen von Papst Benedictus XVI. und Osama bin Laden. Ähnlich verfuhren der Regisseur Stefan Bachmann sowie die Ausstatter*innen Jana Findeklee und Joki Tewes für die Uraufführung von Schnee Weiß. Sie statteten sämtliche Darsteller*innen mit übergroßen Köpfen aus, die die darunter agierenden Körper jeweils grotesk verformten. Groteske Körperlichkeit evozierten zudem die Ganzkörperanzüge, die in dieser Inszenierung eingesetzt wurden und die mit den daran angebrachten Brüsten und Penissen an die stage nakedness der Alten Komödie erinnerten.

Abbildung 20: Elfriede Jelinek: Schnee Weiß (Die Erfindung der alten Leier). Regie: Stefan Bachmann. Schauspiel Köln 2018. Foto: Tommy Hetzel.
Die vielen Masken, die zudem in dieser Inszenierung eingesetzt wurden, offenbarten sich als Bibelzitate und Überreste aus der griechischen Mythologie, weckten aber auch Assoziationen zum bayerisch‐österreichischen Perchten‐Brauchtum und zum Archetypus des (Splatter‑)Clowns. Bachmann reagierte mit dieser inszenatorischen Entscheidung auf eine weitere Spielart des Grotesken, die an die monströse Körperlichkeit der Alten Komödie gemahnt – nämlich an die Vermischung. Wie bereits weiter oben ausgeführt, zeichnen sich sowohl die Komödien des Aristophanes als auch die (post‑)dramatischen Texte Jelineks durch eine Vermischung von als »hoch« und »rein« Konnotiertem mit dem sogenannten Trivialen und Unheiligen aus.
Nun kommt dieses Verfahren freilich nicht ausschließlich in Jelineks Tragödienfortschreibungen vor, sondern durchzieht das gesamte Werk der Autorin. Theatertexte wie Am Königsweg aber legen groteske Verfahren der Vermischung zutage, die genuin paratragisch anmuten, wie anhand der Regiebemerkung, die diesen Text einleitet, demonstriert werden kann:
Miss Piggy, als blinde Seherin hergerichtet, die Augen bluten, wie es die Tradition will. Überhaupt hätte ich in der Folge gern Figuren aus der Muppet Show. Da das aber nicht geht, vielleicht nur Anklänge an die Wesen dort, vielleicht eine Psychose, nein, eine Plüschhose, die an jemandem hängt, ein abnehmbarer Kopf, ein netter Frosch etc. Phantasie, bitte einschalten! Sie sind alle blind. Die einen sind blinde Seher, die treten mit ihrem Blindenstock auf, die andren sind blinde Könige, die treten mit ihren Kronen auf.174
Der Wunsch nach popkulturellen Artefakten, der aus dieser Regieanweisung spricht, adressiert mit der Muppet Show eine Fernsehshow, die sich in eine langjährige angloamerikanische Tradition des Nonsens einreiht und als solche auf ein ihr inhärentes subversives Potenzial verweist.175 Nonsens widersagt logischen und linearen Strukturen und baut stattdessen auf unkonventionelle künstlerische Formen, innovative ästhetische Praktiken und scharfzüngige politische Kommentare. Die Muppet Show partizipiert an diesem Phänomen: Die Sendung wurde erstmals zwischen 1976 und 1981 ausgestrahlt, d.h. in einem Zeitraum, der von massiven sozialen, ökonomischen und politischen Veränderungen im Kontext von Ölkrise und Rezession sowie von feministischen, queeren und Black‐Civil‐Rights‐Bewegungen nachhaltig geprägt war. Viele der scheinbar harmlosen Aussagen der Muppets stellen tradierte Denkmuster im Hinblick auf die Kategorien gender, sex und ethnicity infrage und brechen auf subversive Art mit vorherrschenden gesellschaftlichen Normen. Wenn Jelinek Kermit und Co in Am Köngisweg einen potenziellen Auftritt ermöglicht, dann zitiert sie mithin eine Spielart des Nonsens, die im kollektiven US‑amerikanischen Gedächtnis mit spezifischen Signalen des Umbruchs verknüpft ist.176
Doch sind die Figurationen, die Jelinek in der anfänglichen Regiebemerkung zu Am Königsweg beschreibt, ja nicht nur Anleihen aus der Muppet Show. Sie verfügen darüber hinaus über Attribute, die an Sophokles’ Ödipus und damit an jenen Text erinnern, den Aristoteles als ideale Tragödie schlechthin erachtete. Vor unserem Auge erscheinen hybride Wesen, die zwischen Miss Piggy und antiker Seherin, zwischen Kermit und König Ödipus, zwischen Plüschhose und Herrscherkrone changieren. Die damit einhergehende gegenseitige Durchdringung von sogenannter Hochkultur und Populärkultur lotet die Grenzen kultureller Ordnungen aus und irritiert. Aber lässt sie uns auch lachen?
Als Voraussetzung dafür, dass etwas überhaupt Lachen auszulösen imstande ist, gilt in vielen Lachtheorien die subjektiv empfundene Harmlosigkeit der komischen Situation bzw. des komischen Objekts. Diese Beobachtung findet sich etwa bei Helmuth Plessner, der für potenziell komische Überraschungen Folgendes festhält: »Bedeuten solche Überraschungen und Grenzlagen für uns keine Gefahr, oder haben wir die Kraft, dieser Gefahr gegenüber die Freiheit des Abstandes zu wahren, so finden wir sie – falls die näheren Bedingungen im Phänomen erfüllt sind – komisch.«177
Sigmund Freud wiederum, der in Bezug auf Jelinek und das Komische immer wieder ins Spiel gebracht wird, unterscheidet in seiner einflussreichen Abhandlung Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten (1905) zwischen dem harmlosen und dem tendenziösen Witz.178 Wenngleich Freud hervorhebt, dass der harmlose Witz im Hinblick auf seine Epistemologie wertvoller sei, weil er das Problem des Witzes unverstellt sichtbar mache,179 so spricht er dem tendenziösen Witz zu, seinen Hörer*innen schlichtweg Spaß zu machen. Der tendenziöse Witz verfüge über Quellen der Lust, die dem harmlosen Witz nicht zugänglich seien.180 Freud unterscheidet vier Gattungen des tendenziösen Witzes (den aggressiven oder feindseligen, den sexuellen bzw. obszönen oder entblößenden und den zynischen bzw. skeptischen), die allesamt drei spezifischen Voraussetzungen unterliegen: Sie benötigen (1) jemanden, der den Witz macht, sind (2) an ein Objekt der Aggression gebunden und verlangen (3) nach jemandem, der zuhört und Lust am Witz empfindet. Diese Konstellation zeigt sich im Fall des obszönen Witzes bzw. der Zote als geschlechtlich konnotiert. »Der libidinöse Impuls« des Witzemachers »entfaltet, sowie er die Befriedigung durch das Weib gehemmt findet, eine gegen diese zweite Person feindselige Tendenz und ruft die ursprünglich störende dritte Person zum Bundesgenossen auf.«181 Die »mühelose Befriedigung« der eigenen Libido, die sich beim Zuhörenden des Witzes einstellt, werde durch die Entblößung des »Weibes« durch den Witzemacher garantiert.182 Elementar in diesem Zusammenhang ist Freuds Unterscheidung zwischen Zote und obszönem Witz, die sich als soziale Frage zu erkennen gibt:
Erst wenn wir zu feiner gebildeter Gesellschaft aufsteigen, tritt die formelle Witzbedingung hinzu. Die Zote wird witzig und wird nur geduldet, wenn sie witzig ist. Das technische Mittel, dessen sie sich zumeist bedient, ist die Anspielung, d.h. die Ersetzung durch ein Kleines, ein im entfernten Zusammenhang Befindliches, welches der Hörer in seinem Vorstellen zur vollen und direkten Obszönität rekonstruiert. Je größer das Mißverhältnis zwischen dem in der Zote direkt gegebenen und dem von ihr im Hörer mit Notwendigkeit Angeregten ist, desto feiner wird der Witz, desto höher darf er sich dann auch in die gute Gesellschaft hinaufwagen.183
Erst die über die Anspielung hergestellte Distanzierung vom Gemeinten also, die dem »gemeinen Volke«184 fernliege, erlaube es einer »höheren Bildungs‐ und Gesellschaftsstufe,«185 über einen obszönen Witz zu lachen.
Auffallend an Freuds Witztheorie ist ihre grundsätzliche Gebundenheit an das Prinzip der Ersparnis, das sich auf zwei unterschiedlichen Ebenen zeigt.186 Zum einen begegnen wir ihm im Hinblick auf die Techniken des Wortwitzes, d.h. in der »Ersparung in dem Gebrauch von möglichst wenig oder möglichst den gleichen Worten«187; zum anderen offenbart es sich im »ersparten psychischen Aufwand,«188 aus dem sich der grundlegende Lustgewinn des Witzes speise. Und hier nimmt Freud eine deutliche Unterscheidung vor zwischen dem Wortspiel, dessen »ursprüngliche[r] Lustgewinn«189 aus einer Aufwandsersparnis im Hinblick auf die dafür herangezogenen Worte resultiere, und dem Witz, bei dem sich die Ersparnis auf »den riesigen Aufwand unserer Denktätigkeit«190 verlagere:
Wir dürfen uns wohl den Vergleich der psychischen Ökonomie mit einem Geschäftsbetrieb gestatten. Solange in diesem der Umsatz sehr klein ist, kommt es allerdings darauf an, daß im ganzen wenig verbraucht, die Kosten der Regie aufs äußerste eingeschränkt werden. Die Sparsamkeit geht noch auf die absolute Höhe des Aufwandes. Späterhin, wenn sich der Betrieb vergrößert hat, tritt die Bedeutung der Regiekosten zurück; es liegt nichts mehr daran, zu welcher Höhe sich der Betrag des Aufwandes erhebt, wenn nur Umsatz und Ertrag groß genug gesteigert werden können.191
Gerade vor dem Hintergrund von Jelineks komisch‐tragischen Auseinandersetzungen mit Fragen des Ökonomischen (wie z.B. in Die Kontrakte des Kaufmanns. Eine Wirtschaftskomödie)192 gewinnt dieses von betriebswirtschaftlichen Termini geprägte Denken Freuds an Brisanz.
Den Unterschied zwischen Witz und dem Komischen macht Freud an der Konstellation der jeweils Beteiligten fest. Während der Witz, wie bereits ausgeführt, auf drei Personen angewiesen sei, kämen beim Komischen »im allgemeinen zwei Personen in Betracht, außer meinem Ich die Person, an der ich das Komische finde; wenn mir Gegenstände komisch erscheinen, geschieht dies durch eine in unserem Vorstellungsleben nicht seltene Art von Personifizierung.«193 Während der Witz stets einen Dritten benötige, könne man »das Komische, wo man darauf stößt, alleine genießen« und »herzlich« darüber lachen.194
In der Psychologie erklärt man heute die Entstehung von Lustigkeitseindrücken hauptsächlich im Rückgriff auf das Phänomen der Inkongruenz, d.h. der Abweichung vom Sinnhaften bzw. Gewohnten.195 Das »Inkongruenz‐Lösungs‐Modell« von Suls geht von zwei Phasen aus. In der ersten Phase, so die Annahme, kommt es zu einer Aktivierung, die von einem inkongruenten (unerwarteten) Reiz ausgeht. In der zweiten Phase wird dieser Reiz verarbeitet, d.h. die Überraschung wird aufgelöst, was auf emotionaler Ebene zu Erheiterung führt. Wird die Inkongruenz allerdings nicht oder nur teilweise gelöst, so kann es zu Verwirrung oder Erheiterung kommen (z.B. bei Nonsens Humor). Genau dies sei bei Jelineks Texten und ihren Inszenierungen oftmals der Fall, behaupten Willibald Ruch und Jennifer Hofmann. Die Inkongruenzen, die hier auftreten, provozierten einerseits einen Lustigkeitseffekt, andererseits den Eindruck von Groteskem, Eigenartigem oder gar Verstörendem, so die beiden Psycholog*innen.196
Ob vermeintlich Komisches tatsächlich Lachen entlockt, hat zudem mit einem spezifischen Hintergrundwissen zu tun, über das Rezipient*innen verfügen oder eben nicht. Bereits Henri Bergson hat diagnostiziert, dass das Komische, »soll es voll wirken, etwas wie eine zeitweilige Anästhesie des Herzens voraus[setzt], es wendet sich an den reinen Intellekt.«197 Für Jelineks Texte, die sich – wie Evelyn Annuß erhellend festgestellt hat – in den letzten Jahren vermehrt als eine Art »Bildungsbürgerquiz«198 lesen lassen, ist dieser Faktor äußerst relevant und wirft elementare Fragen von Inklusion und Exklusion in Bezug auf die Kategorien Klasse und Herkunft auf. Ähnlich verhält es sich mit den paratragischen Komödien des Aristophanes. Die Decodierung paratragischer Einschübe setzte auch im alten Athen ein gewisses Bildungskapital voraus, über das nicht jeder verfügte. Der »durchschnittliche«, d.h. männliche, freie attische Bürger war aufgrund seiner regelmäßigen Teilnahme an den Dionysien imstande, komische Anspielungen auf Tragödien, die in den vorangegangenen Jahren ausgetragen worden waren, zu verstehen. Vollständig erschlossen sich diese Bezüge aber wohl lediglich einem ausgewählten Kreis von Intellektuellen rund um den jeweiligen Stückeschreiber.
Ob potenziell komisch wirkende Überraschungen imstande sind, Lachen zu provozieren, hängt also von mehreren Faktoren ab. Es betrifft auch den Grad der damit einhergehenden Normüberschreitung. So tangiert die Komik innerhalb von Jelineks Texten bekanntermaßen vorrangig gesellschaftlich tabuisierte Bereiche. Die daraus resultierende Inkongruenz lässt ein Lachen oftmals als deplatziert erscheinen und löst mitunter auch Affekte und Emotionen wie Trauer, Scham, Abscheu und Wut aus. In keinem Fall ist das Lachen, das Jelineks Texte potenziell triggern, ein »explosionsartige[s] Lachen«199, das Freud zufolge erst einen guten Witz bezeuge. Insofern ist es fraglich, ob in Bezug auf das Komische bei Jelinek überhaupt von Witz zu sprechen ist. Schließlich wird der Witz, so Samuel Weber in Anlehnung an Freud, »erst witzig, indem über ihn gelacht wird. Lacht man nicht, so ist auch der beste Witz keiner. Der Witz löst das Lachen aus, das ihn nachträglich zum Witz macht.«200 Jelineks Theater der Durchquerung lässt ein Lachen hörbar werden, das beständig vom Komischen ins Tragische kippt und umgekehrt. Und auch diesbezüglich zeigen sich Verbindungen zur Ästhetik des griechischen Theaters, wie abschließend gezeigt werden will.
Endnoten
36 Vgl. Zimmermann, Bernhard: »Aristophanes«, S. 157.
37 Vgl. Hanink, Johanna: »Crossing Genres: Comedy, Tragedy, and Satyr Play«, S. 264 bzw. FN 4.
38 Zimmermann, Bernhard: »Eine kleine Poetik des Requisits. Zu Aristophanes, Acharner 393–489.« In: Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete 57/2 (2011), S. 430–433, hier S. 433.
39 Ebd., S. 433.
40 Foley, Helene: »Generic Boundaries in Fifth‐Century Athens.« In: Revermann, Martin/Wilson, Peter (Hg.): Performance, Iconography, Reception: Studies in Honour of Oliver Taplin. Oxford: Oxford University Press 2008, S. 15–33, hier S. 22.
41 In einem Interview mit dem Dramaturgen Joachim Lux spricht Jelinek davon, entstandenes Pathos »gleich wieder durch den Sarkasmus sozusagen in die eigene Distanzierung zurückzuzerren, zu brechen« (Lux, Joachim: »Was fallen kann, das wird auch fallen.« In: Programmheft zu Elfriede Jelineks »Das Werk.« Burgtheater Wien: 2003).
42 Jelinek, Elfriede: »Die Kontrakte des Kaufmanns. Eine Wirtschaftskomödie.« In: Dies.: Drei Theaterstücke: Die Kontrakte des Kaufmanns. Rechnitz (Der Würgeengel). Über Tiere. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2009, S. 207–349, hier S. 349.
43 Vgl. Janke, Pia (Hg.): Elfriede Jelinek: Werk und Rezeption. 2 Bände: Bd. 2. Wien: Praesens 2014, S. 172.
44 Jelinek, Elfriede: »Geld oder Leben! Das Schreckliche ist immer des Komischen Anfang. E‑Mail‐Wechsel mit Joachim Lux.« In: Programmheft zu Elfriede Jelineks »Die Kontrakte des Kaufmanns«. Berlin: Deutsches Theater 2009.
45 Thiele, Rita: »Glücklich ist, wer vergisst? Eine E‑Mail‐Korrespondenz zwischen Elfriede Jelinek und Rita Thiele.« In: Programmheft zu Elfriede Jelineks »Das Werk/Im Bus/Ein Sturz.« Schauspiel Köln: 2010.
46 Zu Merkmalen des sogenannten Paratragischen vgl. v.a. Rau, Peter: Paratragodia: Untersuchung einer komischen Form des Aristophanes. München: C.H. Beck 1967; Seidensticker, Bernd: Palintonos Harmonia: Studien zu komischen Elementen in der griechischen Tragödie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1982; Silk, Michael S.: »Aristophanic Paratragedy.« In: Sommerstein, Alan H. et al. (Hg.): Tragedy, Comedy, and the Polis. Bari: Levante Editori 1993, S. 477–504; Medda, Enrico/Mirto, Maria Serena/Pattoni, Pia (Hg.): Kωμωιδοτραγωιδία: Intersezioni del tragico e del comico nel teatro del V secolo a. C. Pisa: Edizioni della Normale 2006; Rosen, Ralph M.: »Aristophanes, Old Comedy and Greek Tragedy.« In: Bushnell, Rebecca (Hg.): The Blackwell Companion to Tragedy. Oxford: Blackwell 2006, S. 251–268; Miles, Sarah N.: Strattis, Tragedy and Comedy. Unpublished dissertation, University of Nottingham 2009; Hanink, Johanna: »Crossing Genres: Comedy, Tragedy, and Satyr Play.«
47 Eine diesbezügliche Ausnahme stellt Aischylos’ Tragödie Die Perser dar, die sich am historischen Untergang der persischen Flotte im Zuge der Seeschacht von Salamis orientiert.
48 Zimmermann, Bernhard: »Aristophanes«, S. 145.
49 Vgl. hierzu auch das Kapitel Vibrant Matter.
50 Haß, Ulrike: »Palimpseste für ein Theater der Gegenwart.« In: Felber, Silke/Hippesroither, Wera (Hg.): Spuren des Tragischen im Theater der Gegenwart. Tübingen: Narr 2020, S. 15–32, hier S. 15.
51 Ebd., S. 15–16.
52 Thiele, Rita: »Glücklich ist, wer vergisst? Eine E‑Mail‐Korrespondenz zwischen Elfriede Jelinek und Rita Thiele«.
53 Jelinek, Elfriede: »Anmerkung zu Ein Sturz.« In: Schauspiel Köln (Hg.): Schauspiel Köln Werkschau 2007–2013. Intendanz: Karin Beier. Köln: Walther König 2013, S. 262.
54 Hanink, Johanna: »Crossing Genres: Comedy, Tragedy, and Satyr Play«, S. 263.
55 Vgl. Henderson, Jeffrey: »Comedy in the Fourth Century II: Politics and Domesticity.« In: Fontaine, Michael/Scafuro, Adele C. (Hg.): The Oxford Handbook of Greek and Roman Comedy, S. 181–198, hier S. 182.
56 Um die Politik und Person des Perikles öffentlich kritisieren zu können, entwarfen Kratinus und Hermippos in den späten 430er‐Jahren, im Vorfeld des Peloponnesischen Krieges, ein Subgenre, indem sie sich des Mythos bedienten. Dieser Zugang prägt auch noch die frühe Komödie des Aristophanes, d.h. die 426 v. Chr. verfassten Babylonier. Der Aufstieg von Kleon inspirierte den Dichter dann, von den mythologischen, verschleiernden komischen Strategien abzulassen. Mit den Acharnern (425 v. Chr.) entstand erstmals eine Komödie, in der die attische Politik offen attackiert und Kleon unmissverständlich verspottet wurde. Der neuartige Stil und das soziopolitische Engagement des jungen Aristophanes, der sich die durch den Peloponnesischen Krieg verursachten bzw. verschärften Spannungen zunutze machte, bescherten ihm eine Reihe von Erfolgen und Nachahmern. Wenngleich die von Aristophanes begründete politische Komödie nach 403 v. Chr. anfing, anderen Genres Platz zu machen, so dauerte es noch viele Jahrzehnte, bis sie sich gänzlich von ihrem politischen Engagement abwandte. Vgl. hierzu Henderson, Jeffrey: »Comedy in the Fourth Century II: Politics and Domesticity«, S. 183.
57 Jelinek, Elfriede: »Das Lebewohl.« In: Dies.: Das Lebewohl. 3 kl. Dramen. Berlin: Berlin Verlag 2000, S. 7–35, hier S. 9 [Herv. SF].
58 Vgl. Haider, Jörg: »Glücksgefühl nach bangen Stunden.« In: News 10/2000, S. 30–31.
59 Jelinek, Elfriede: »Das Lebewohl«, S. 25.
60 Zu den Bezügen zu Aischylos vgl. Kallin, Britta: »Jörg Haider as a Contemporary Orestes. Aischylos’s Oresteia in Elfriede Jelinek’s Das Lebewohl.« In: Seminar 4/2003, S. 329–349.
61 Jelinek, Elfriede: »Das Lebewohl«, S. 34.
62 Ebd., S. 13.
63 Vgl. Zum folgenden Absatz: Felber, Silke: »›E’onesto sporcare il proprio nido?‹ Zur Wahrnehmung der Österreichkritik Jelineks in Italien.« https://jelinektabu.univie.ac.at/sanktion/stigmatisierung/silke-felber 28.11.2013 [Zugriff am 1.9.2020].
64 Waas, Werner: »Selbstbefragung zu Elfriede Jelinek in Italien.« In: Secci, Lia (Hg.): Il teatro di Elfriede Jelinek in Italia. Rom: Aracne 2011, S. 121–137, hier S. 128–129.
65 Jelinek, Elfriede: Das Kommen. https://www.elfriedejelinek.com/fdaskommen.htm 26.4.2016/18.10.2016 [Zugriff am 8.12.2020] (= Elfriede Jelineks Website, Rubrik Theatertexte).
66 Jelinek, Elfriede: Die Schutzbefohlenen. http://elfriedejelinek.com/fschutzbefohlene.htm 14.6.2013/8.11.2013/14.11.2014/29.9.2015/23.1.2017 [Zugriff am 5.2.2019] (= Elfriede Jelineks Website, Rubrik Theatertexte), im Folgenden zitiert mit der Sigle SCH.
67 Vgl. Meier, Christian: Die politische Kunst der griechischen Tragödie. München: Beck 1988, S. 109.
68 Die Kriterien, nach denen eine »Promi‐Einbürgerung« in Österreich erfolgt, waren zum Entstehungszeitraum von Die Schutzbefohlenen nicht transparent und sorgten als solche für Kritik. Im Februar 2014 wurde von Innenministerin Mikl‐Leitner (ÖVP) ein Kriterienkatalog für solche Einbürgerungen zum Beschluss gebracht, der jedoch nicht für die Öffentlichkeit einsehbar ist. (Vgl. dazu Brickner, Irene: »Kriterienliste für Promi‐Einbürgerungen bleibt Amtsgeheimnis.« In: Der Standard, 16.6.2014.)
69 Der Text ist eine Überarbeitung des bis dato unpublizierten Manuskripts Der Einzige, sein Eigentum (Hello darkness my old friend), vgl. Felber, Silke: »Am Königsweg.« In: Biger‐Marschall, Ingrid/Marschall, Brigitte (Hg.): Lexikon der deutschsprachigen und internationalen Dramatik. Bd. 23. Stuttgart: Hiersemann 2019, S. 49–50, hier S. 49.
70 Jelinek, Elfriede: »Am Königsweg.« In: Dies.: Schwarzwasser. Am Königsweg. Zwei Theaterstücke. Berlin: Rowohlt 2020, S. 1–148., hier S. 144.
71 Vgl. zum Folgenden: Felber, Silke: »Blind vor Hass. Elfriede Jelineks Ödipus‐Fortschreibung Am Königsweg.« In: Brokoff, Jürgen/Walter‐Jochum, Robert (Hg.): Hass/Literatur. Literatur‐ und kulturwissenschaftliche Beiträge zu einer Theorie‐ und Diskursgeschichte. Bielefeld: transcript 2019, S. 343–354, hier S. 345f.
72 Girard, René: Das Heilige und die Gewalt. Ostfildern: Patmos 2012, S. 107.
73 Ebd., S. 118.
74 Jelinek, Elfriede: »Am Königsweg«, S. 143.
75 Ebd., S. 240.
76 Vgl. hierzu auch Unterkapitel Reisende Gesten?
77 Vgl. hierzu auch das Unterkapitel Wahnsinnig komisch? Parakomische Elemente bei Euripides und Jelinek.
78 Jelinek, Elfriede: »Schwarzwasser.« In: Dies.: Schwarzwasser. Am Königsweg. Zwei Theaterstücke. Berlin: Rowohlt 2020, S. 149–240, hier S. 179–180.
79 Vgl. hierzu v.a. Wodak, Ruth: Politik mit der Angst. Zur Wirkung rechtspopulistischer Diskurse. Wien/Hamburg: Konturen 2016, S. 40ff.
80 Jelinek, Elfriede: »Schwarzwasser«, S. 185.
81 Ebd., S. 185.
82 Freud, Sigmund: Gesammelte Werke VI: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten. Hgg. v. Anna Freud. Frankfurt a.M.: Fischer 1987, S. 136.
83 Ebd., S. 137.
84 Zur Beziehung zwischen den komischen Verfahren Jelineks und Freuds Ausführungen zum Witz vgl. das Unterkapitel Groteske Körperlichkeit.
85 Freud, Sigmund: Gesammelte Werke VI, S. 137.
86 Ebd., S. 138.
87 Haß, Ulrike: »Theaterästhetik. Textformen.« In: Janke, Pia (Hg.): Jelinek Handbuch. Stuttgart: Metzler 2013, S. 62–68, hier S. 67.
88 Heeg, Günther: »Tragik.« In: Fischer‐Lichte, Erika/Kolesch, Doris/Warstat, Matthias (Hg.): Metzler Lexikon Theatertheorie. Stuttgart/Weimar: Metzler 2014, S. 388–394, hier S. 394.
89 Schleef, Einar: Droge – Faust – Parsifal. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1999, S. 377.
90 Bierl, Anton: Der Chor in der Alten Komödie, S. 105.
91 Jelinek, Elfriede: Ein Sportstück. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1998, S. 7, im Folgenden zitiert mit der Sigle SP.
92 Jelinek, Elfriede: »Das Werk.« In: Dies.: In den Alpen. Drei Dramen. Berlin: Berlin Verlag 2002, S. 89–251, im Folgenden zitiert mit der Sigle WE.
93 https://www.kaprun.co/Kraftwerk-Kaprun [Zugriff am 9.12.2020] (= Website der Gemeinde Kaprun).
94 In den Alpen thematisiert das Gletscherbahnunglück in Kaprun im Jahr 2000, vgl. dazu das Kapitel Die Bakchen im Skizirkus. Dieses Thema taucht auch in Das Werk auf.
95 Nachbemerkung zu Das Werk, in: Jelinek, Elfriede: »Das Werk«, S. 257–58.
96 Lux, Joachim: »Was fallen kann, das wird auch fallen«.
97 Die Arbeit wurde am 29.10.2010 am Schauspiel Köln zur Uraufführung gebracht. Vgl. dazu auch Janke, Pia (Hg.): Elfriede Jelinek: Werk und Rezeption. Bd. 2, S. 178–179.
98 Vgl. Schürmann, Inge: »Von der Bergung zur Ursachenforschung und Beweissicherung.« https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/presse/von-der-bergung-zur-ursachenforschung-und-beweissicherung 23.10.2012 [Zugriff am 3.8.2017] (= Amt für Presse‐ und Öffentlichkeitsarbeit, Stadt Köln).
99 Vgl. Rügemer, Werner: Colonia Corrupta. Globalisierung, Privatisierung und Korruption im Schatten des Kölner Klüngels. Münster: Westfälisches Dampfboot 2010.
100 Jelinek, Elfriede: Ein Sturz. Unveröffentlichtes Bühnenmanuskript. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2010, S. 3f., im Folgenden zitiert mit der Sigle ES.
101 Vgl. Männlein‐Robert, Irmgard: »Poetik: Komödie und Tragödie (VII 796e–817e).« In: Horn, Christoph (Hg.): Platon Gesetze – Nomoi. Berlin: Akademie Verlag 2013, S. 123–141, hier S. 129.
102 Platon: Nomoi (De legibus). Die Gesetze. Erstes Buch. Übers. v. Franz Susemihl (Stuttgart 1862–63) https://www.opera-platonis.de/Nomoi.pdf [Zugriff am 11.9.2020] 816de–e.
103 Bachtin, Michail M.: Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1985, S. 32.
104 Ebd., S. 34. Vgl. hierzu auch Wirth, Uwe: »Bachtins Ansatz im Spannungsfeld von Karneval und Literatur.« In: Ders. (Hg.): Komik. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart/Weimar: Metzler 2017, S. 128–129, hier S. 128.
105 Thiele, Rita: »Katerstimmung im Rheinland.« In: Theater heute Jahrbuch 2010, S. 178.
106 In Bezug auf jüngere diesbezügliche Forschungen vgl. Janke, Pia/Schenkermayr, Christian (Hg.): Komik und Subversion. Ideologiekritische Strategien. Zu Jelinek und Freud vgl. das Unterkapitel Groteske Körperlichkeit.
107 Haß, Ulrike/Meister, Monika: »Das Komische in der Präsenz der Szene. Komik, Figuration und Körperlichkeit bei Elfriede Jelinek. E‑Mail‐Wechsel zwischen Ulrike Haß und Monika Meister.« https://fpjelinek.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/proj_ejfz/PDF-Downloads/Haß-Meister_.pdf [Zugriff am 2.10.2020].
108 Vgl. dazu exemplarisch Meister, Monika: »Theaterästhetik. Bezüge zur Theatertradition.« In: Janke, Pia (Hg.): Jelinek Handbuch, S. 68–73, hier S. 69–70 und Kovacs, Teresa: Drama als Störung. Elfriede Jelineks Konzept des Sekundärdramas. Bielefeld: transcript 2016, S. 14.
109 Kovacs, Teresa: »›… die ehernen Blöcke männlichen Schaffens umkreisen‹ – Elfriede Jelinek queert Lessing und Goethe.« In: Aussiger Beiträge 10 (2016), S. 81–97, hier S. 82.
110 Vogel, Juliane: »Intertextualität.« In: Janke, Pia (Hg.): Jelinek Handbuch, S. 47–55, hier S. 47.
111 Mastronarde, Donald J.: The Art of Euripides. Dramatic Technique and Social Context. Cambridge: Cambridge University Press 2010, S. 49.
112 Aristophanes: Frauen in der Volksversammlung. Übers.u. hgg. v. Niklas Holzberg. Stuttgart: Reclam 2017, 1170–1175, künftig abgekürzt mit der Sigle Arist. Fr.
113 Vgl. Nelson, Stephanie: Aristophanes and His Tragic Muse, S. 12.
114 Jelinek, Elfriede: »Anmerkung zu Ein Sturz«.
115 Vgl. zu den folgenden Ausführungen Felber, Silke: »Provokationen. Zur Funktion der Klage in Elfriede Jelineks Tragödienfortschreibungen.« In: Degner, Uta/Gürtler, Christa (Hg.): Elfriede Jelinek im literarischen Feld – Positionierungen, Provokationen, Polemiken. Berlin/New York: de Gruyter 2021, S. 219–230.
116 Vgl. Aischylos: »Agamemnon.« In: Ders.: Orestie. Übers. v. Oskar Werner. Berlin/New York: de Gruyter 2014, S. 5–122, hier S. 29.
117 Seidensticker, Bernd: »Vorwort.« In: Aischylos: Die Tragödien. Hgg. v. Bernd Seidensticker. Stuttgart: Kröner 2016, S. I–XL, hier S. XXX.
118 Jelinek ruft dadurch ex negativo den bereits in anderen Theatertexten zitierten Hesiod auf, der in seinem epischen Lehrgedicht Erga erstmals auf die Verbindung jener beiden, durch Liquidität charakterisierten, Elemente des Wassers und des Geldes hingewiesen hat. Vgl. dazu auch Blumenberg, Hans: Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinsmetapher. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2014, S. 12.
119 Jelinek, Elfriede: »Die Kontrakte des Kaufmanns. Eine Wirtschaftskomödie«, S. 288, Herv. SF.
120 Elfriede Jelinek in: Hoffmann, Yasmin: »Sujet impossible suivi de Ich will seicht sein et d’un entretien avec Elfriede Jelinek.« In: Germanica 18 (1996), S. 153–175, hier S. 175.
121 Zimmermann, Bernhard: »Aristophanes«, S. 137.
122 Vgl. ebd., S. 137.
123 Wright, Elinor: The Forms of Laments in Greek Tragedy. Diss. Univ. of Pennsylvania 1986.
124 Suter, Ann: »Lament in Euripides’ Trojan Women.« In: Mnemosyne 56 (2003), S. 1–28, hier S. 1.
125 Zum komischen Potenzial der Wiederholung in der Alten Komödie vgl. Kloss, Gerrit: Erscheinungsformen komischen Sprechens. Berlin/New York: de Gruyter 2001, S. 204–237; Miller, H. W.: »Repetitions of Lines in Aristophanes.« In: AJPh 65 (1944), S. 26–36; Miller, H. W.: »Comic Iteration in Aristophanes.« In: AJPh 66 (1945), S. 398–408.
126 Jelinek, Elfriede: »Kalauer sind die Augenblicke der Wahrheit.« https://www.nachtkritik-stuecke2010.de/elfriedejelinek/sieben-fragen 7.4.2018 [Zugriff am 2.10.2020].
127 Sigmund Freud zufolge stellen Kalauer »den mindesten Anspruch an die Technik des Ausdrucks wie das eigentliche Wortspiel den höchsten. Wenn bei letzterem die beiden Bedeutungen in dem identischen und darum meist nur einmal gesetzten Wort ihren Ausdruck finden sollen, so genügt beim Kalauer, daß die zwei Worte für die beiden Bedeutungen durch irgend eine, aber unübersehbare Ähnlichkeit aneinander erinnern, sei es durch eine allgemeine Ähnlichkeit ihrer Struktur, einen reimartigen Gleichklang, die Gemeinsamkeit einiger anlautender Buchstaben u. dgl.« (Freud, Sigmund: Gesammelte Werke VI: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 102.)
128 Vgl. Suter, Ann: »Lament in Euripides’ Trojan Women«, S. 10.
129 Stemann, Nicolas/Villiger Heilig, Barbara: »Diese Sprache will gesprochen werden.« In: Neue Zürcher Zeitung, 20.10.2016, Herv. SF.
130 Vgl. Fleig, Anne: »Zitierte Autorität – Zur Reflexion von Autorschaft in Rosamunde, Ulrike Maria Stuart und den Sekundärdramen.« In: Klein, Delphine/Vennemann, Aline (Hg.): »Machen Sie, was Sie wollen!« Autorität durchsetzen, absetzen und umsetzen. Deutsch‐ und französischsprachige Studien zum Werk Elfriede Jelineks. Wien: Praesens 2017, S. 148–169, hier S. 149.
131 Ebd, S. 149.
132 Hanink, Johanna: »Crossing Genres: Comedy, Tragedy, and Satyr Play«, S. 266.
133 Taplin, Oliver: »Fifth‐Century Tragedy and Comedy: A Synkrisis,« S. 168.
134 Vgl. ebd., S. 168.
135 Aristophanes: Wespen. Übers., hgg. u. komm. v. Lutz Lenz. Berlin/Boston: de Gruyter 2014, S. 221–222 (1015-1121).
136 Jelinek, Elfriede: Winterreise. Ein Theaterstück. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2012, S. 117.
137 Vgl. Felber, Silke: »›Auf Verschwundenen stehend, läuft uns unser Leben voraus.‹ Zur ästhetischen und politischen Dimension des Alter(n)s in Elfriede Jelineks und Franz Schuberts Winterreise.« In: Limbus. Australian Yearbook of German Literary and Cultural Studies 8: Ageing/Altern. Freiburg et al.: Rombach 2015, S. 49–66, hier S. 61–62.
138 Jelinek, Elfriede: Winterreise, S. 117.
139 Schleef, Einar: Droge – Faust – Parsifal, S. 266.
140 Ebd., S. 265.
141 Schmidt, Christina: Tragödie als Bühnenform. Einar Schleefs Chor‐Theater. Bielefeld: transcript 2010, S. 54.
142 Vgl. Jürs‐Munby, Karen: »Inszenierungsformen.« In: Janke, Pia (Hg.): Jelinek Handbuch, S. 324–334, hier S. 328. Zu Einar Schleefs Inszenierung aus einer probenästhetischen Perspektive vgl. auch Cortese, Roberta: »Schleefs Sportstück‐Inszenierung – Ein Probenbericht.« In: Janke, Pia (Hg.): Elfriede Jelinek – Ich will kein Theater. Wien: Praesens 2007, S. 127–130.
143 Haß, Ulrike: »Theaterästhetik. Textformen«, S. 67.
144 Ebd., S. 67.
145 Vgl. dazu auch Möseneder, Martina: Sprache im Theater Elfriede Jelineks, S. 103.
146 Jelinek, Elfriede: Macht nichts. Eine kleine Tragödie des Todes. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1999, S. 90 [Herv. SF].
147 Jelinek, Elfriede: »Im Abseits (Nobelvorlesung).« In: Janke, Pia (Hg.): Literaturnobelpreis Elfriede Jelinek. Wien: Praesens 2005, S. 227–38, hier S. 230–31, Herv. SF.
148 Svandrlik, Rita: »›Die Autorin ist weg. Sie ist nicht der Weg.‹ Vom vergeblichen Verschwinden der Autorin (Gier und Im Abseits).« In: Klein, Delphine/Vennemann, Aline (Hg.): »Machen Sie, was Sie wollen!«, S. 85–95, hier S. 86.
149 Vgl. hierzu auch Möseneder, Martina: Sprache im Theater Elfriede Jelineks, S. 103.
150 Jürs‐Munby, Karen: »Inszenierungsformen«, S. 325.
151 Klein, Delphine/Vennemann, Aline: »Einleitung.« In: Dies. (Hg.): »Machen Sie, was Sie wollen!«, S. 8–19, hier S. 14.
152 Ebd., S. 14.
153 Jelinek, Elfriede: »Schatten (Eurydike sagt).« In: Theater heute 10/2012 (Beilage), S. 3, Herv. SF.
154 Stephan, Inge: »Ver/Lustgeschichten. Überlegungen zu Elfriede Jelineks Schatten (Eurydike sagt).« In: Felber, Silke (Hg.): Kapital Macht Geschlecht. Künstlerische Auseinandersetzungen mit Ökonomie und Gender. Wien: Praesens 2016, S. 67–73, hier S. 68.
155 Vgl. hierzu ebd., S. 68.
156 Ebd., S. 70.
157 Jelinek, Elfriede: »Schatten (Eurydike sagt)«, S. 18.
158 Vgl. Jelinek, Elfriede: »Meine gute Textwurst.« http://elfriedejelinek.com/fnestroy2.htm 9.11.2013 [Zugriff am 19.10.2018] (= Elfriede Jelineks Website, Rubrik Zu Politik und Gesellschaft).
159 Pewny, Katharina: »Elfriede Jelineks mehrfache Intermedialität oder: Desiderata der Jelinek‐Forschung, etwa auf den Spuren von Plüsch‐Teddybären.« In: Janke, Pia/Kovacs, Teresa (Hg.): »Postdramatik«. Reflexion und Revision. Wien: Praesens 2015, S. 242–254, hier S. 249.
160 Jelinek, Elfriede: Das schweigende Mädchen. Unveröffentlichtes Bühnenmanuskript. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2014, S. 224.
161 Ebd., S. 216.
162 Ebd., S. 218.
163 Taplin, Oliver: »Fifth‐Century Tragedy and Comedy: A Synkrisis«, S. 170. Alan Hughes hebt für die metatheatrale Bedeutung des Kostüms innerhalb der Komödie Folgendes hervor: »Greek comedies are full of verbal stage directions, many of them concerning clothes. After food and drink, clothes are perhaps the most frequently named objects in the plays and fragments.« (Hughes, Alan: »The Costumes of Old and Middle Comedy.« In: Bulletin of the Institute of Classical Studies 49/1 (2006), S. 39–68, hier S. 39.)
164 Muecke, Frances: »›I Know You – By Your Rags.‹ Costume and Disguise in Fifth‐century Drama.« In: Antichthon 16 (1982), S. 17–34, hier S. 29.
165 Jelinek, Elfriede: Abraumhalde. https://www.elfriedejelinek.com/farhalde.htm 4.10.2009 (Fassung vom 30.5.2008) [Zugriff am 15.2.2021] (= Elfriede Jelineks Website, Rubrik Theatertexte).
166 Vgl. dazu Hughes, Alan: Performing Greek Comedy, S. 167f.
167 Garland‐Thomson, Rosemary: »Introduction. From Wonder to Error – A Geneology of Freak Discourse in Modernity.« In: Dies. (Hg.): Freakery. Cultural Spectacles of the Extraordinary Body. New York/London: New York University Press 1996, S. 1–22, hier S. 2.
168 Hughes, Alan: »The Costumes of Old and Middle Comedy«, S. 42.
169 »Private life was separated from the political sphere, actors from dancers, mind from body, gods from mortals, Greek master from the natural slave, and mask from the body of the actor.« Wiles, David: »The Poetics of the Mask in Old Comedy.« In: Revermann, Martin/Wilson, Peter (Hg.): Performance, Iconography, Reception, S. 374–392, hier S. 375.
170 Wiles, David: »The Poetics of the Mask in Old Comedy«, S. 375.
171 Hughes, Alan: Performing Greek Comedy, S. 176.
172 Jelinek, Elfriede: »Ich schlage sozusagen mit der Axt drein.« In: TheaterZeitSchrift 7 (1984), S. 14–16, hier S. 14.
173 Fuß, Peter: Das Groteske. Ein Medium des kulturellen Wandels. Köln et al.: Böhlau 2001, S. 302.
174 Jelinek, Elfriede: »Am Königsweg«, S. 2.
175 Nonsens entsteht im 18. Jahrhundert als Reaktion auf die rationalen und fortschrittsoptimistischen Bestrebungen der Aufklärung. Als Beispiele seien hier etwa der Nursery Rhyme Hey Diddle Diddle und Lewis Carrolls Jabberwocky genannt. Vgl. Abate, Michelle Ann: »Taking Silliness Seriously: Jim Henson’s ›The Muppet Show‹, the Anglo‐American Tradition of Nonsense, and Cultural Critique.« In: The Journal of Popular Culture 42/4 (2009), S. 589–613. Vgl. zum folgenden Absatz: Felber, Silke: »Blind vor Hass. Elfriede Jelineks Ödipus‐Fortschreibung Am Königsweg«, S. 345f.
176 Vgl. Felber, Silke: »Blind vor Hass. Elfriede Jelineks Ödipus‐Fortschreibung Am Königsweg.« In: Brokoff, Jürgen/Walter‐Jochum, Robert (Hg.): Hass/Literatur. Literatur‐ und kulturwissenschaftliche Beiträge zu einer Theorie‐ und Diskursgeschichte. Bielefeld: transcript 2019, S. 343–354, hier S. 345.
177 Plessner, Helmuth: »Lachen und Weinen. Eine Untersuchung nach den Grenzen menschlichen Verhaltens (1941).« In: Ders.: Gesammelte Schriften. Bd. 7: Ausdruck und menschliche Natur. Hgg. v. Günter Dux et al. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1982, S. 290–304, hier S. 304.
178 Zum obszönen Witz bei Freud und Jelinek vgl. Finney, Gail: »Komödie und Obszönität. Der sexuelle Witz bei Jelinek und Freud.« In: The German Quarterly 70/1 (1997), S. 27–38. Zu psychoanalytischen Zugängen zum Werk Jelineks vgl. exemplarisch Finney, Gail/Pełka, Artur: »Komik, Körper und Subversion – Psychoanalytische Zugänge zu Jelineks Werk.« In: Janke, Pia/Schenkermayr, Christian (Hg.): Komik und Subversion. Ideologiekritische Strategien, S. 317–323; Pełka, Artur/Wetzel, Michael: »Die Lust an der Unlust – Psychoanalytische Aspekte des Witzes bei Elfriede Jelinek.« In: Janke, Pia/Schenkermayr, Christian (Hg.): Komik und Subversion. Ideologiekritische Strategien, S. 96–106.
179 »Für unsere theoretische Aufklärung über das Wesen des Witzes müssen uns die harmlosen Witze wertvoller sein als die tendenziösen, die gehaltlosen wertvoller als die tiefsinnigen. Harmlose und gehaltlose Wortspiele etwa werden uns das Problem des Witzes in seiner reinsten Form entgegenbringen, weil wir bei ihnen die Gefahr der Verwirrung durch die Tendenz und der Urteilstäuschung durch den guten Sinn entgehen.« (Freud, Sigmund: Gesammelte Werke VI: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 102.)
180 Vgl. ebd., S. 105.
181 Ebd., S. 109.
182 Ebd., S. 109.
183 Ebd., S. 109–110.
184 Ebd., S. 109.
185 Ebd., S. 110.
186 Zur Ökonomie des Witzes bei Freud vgl. Menke, Bettine: »Der janusköpfige Witz – ein ›doppelzüngiger Schelm, der gleichzeitig zweien Herren dient‹.« In: Dies.: Einfälle, Zufälle, Ausfälle. Der Witz der Sprache. Paderborn: Fink 2021, S. 443–519.
187 Freud, Sigmund: Gesammelte Werke VI: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 133.
188 Ebd., S. 133.
189 Ebd., S. 175.
190 Ebd., S. 175.
191 Freud, Sigmund: Gesammelte Werke VI: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 175.
192 Zu Fragen des Ökonomischen bei Jelinek vgl. Felber, Silke (Hg.): Kapital Macht Geschlecht.
193 Ebd., S. 161.
194 Ebd., S. 160.
195 Vgl. Ruch, Willibald/Hofmann, Jennifer: »Komik im Werk Elfriede Jelineks.« https://fpjelinek.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/proj_ejfz/PDF-Downloads/Komik_-_Ruch-Hofmann.pdf [Zugriff am 19.10.2020].
196 Vgl. ebd.
197 Bergson, Henri: Das Lachen. Meisenheim am Glan: Westkulturverlag Anton Hain 1948, S. 9.
198 Evelyn Annuß in einem Gespräch mit Claudia Bossard und Gerhild Steinbuch (Moderation: Andrea Heinz) mit dem Titel Störung, Unterbrechung, Subversion: Politisch‐ästhetische Strategien im Werk X, Wien, 28.11.2019 https://www.youtube.com/watch?v=MtN_-Rrb65Q&feature=emb_logo [Zugriff am 10.12.2020].
199 Freud, Sigmund: Gesammelte Werke VI: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 88.
200 Weber, Samuel: »Die Zeit des Lachens.« In: Fragmente 66 (Heilloses Lachen: Fragmente zum Witz) (1994), S. 77–90, hier S. 81.