Ende der 1980er-Jahre schlug der Literaturwissenschafter George Steiner ein Gedankenexperiment vor, das für viele eher nach einer Dystopie klang: „Man stelle sich eine Gesellschaft vor, in der jedes Gespräch über Kunst, Musik und Literatur verboten ist.“ (Steiner 1990: 15). In dieser „gegenplatonischen Republik“ von Schriftstellerinnen und Künstlern, aus der Rezensenten und Kritikerinnen verbannt wurden, wären nur „leidenschaftslose Zusammenfassungen der Neuerscheinungen“ erlaubt. Interpretieren hieße in dieser Stadt ausführen: wie eine Schauspielerin Ophelia oder ein Geiger Bach interpretiert.
Eine solche Parabel als Metakritik am Geschäft der Kritiker_innen beunruhigt allgemein, auch weil sie als Angriff auf eine zentrale Errungenschaft der abendländischen Kultur empfunden wird. Adorno war einer ihrer Lobredner: „Kritik ist aller Demokratie wesentlich. […] Sie wird durch Kritik geradezu definiert. […] Wenig übertreibt, wer den neuzeitlichen Begriff der Vernunft mit Kritik gleichsetzt.“ (Adorno 1971: 10 f)
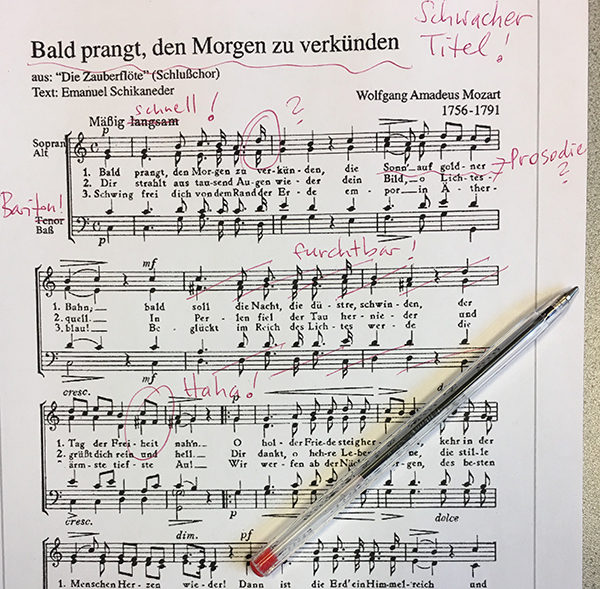
Historische Textkritik
Dürfen wir uns denn angesichts eines solchen Befundes erlauben, Kritik abzulehnen? Würden außerdem Kunst, Musik und Literatur ohne Kritik nicht ihre gesellschaftliche Funktion verlieren und zur Beliebigkeit und Belanglosigkeit verkommen?
Solche Debatten, die alle zehn Jahre aufflammen, gehen auf ein gründliches Missverständnis, besser: auf eine Homonymie zurück. Die verschiedenen Bedeutungen des Wortes Kritik werden darin miteinander vermischt und Unterschiede eingeebnet.
Kritik taucht als Begriff und Konzeption im 17. Jahrhundert im Rahmen einer neuartigen hermeneutischen Methode (wieder) auf. Die Methode wird „Historische Textkritik“ („Critica sacra“) genannt und bei der Lektüre der heiligen Bücher angewendet. Sie dient etwa der Überprüfung der Echtheit des Textes, dem Vergleich historisch bedingter unterschiedlicher Lesarten von Wörtern und dem Feststellen des Autors – ganz im Sinne der Begriffsbedeutung: Das griechische krinein heißt scheiden, trennen, entscheiden, urteilen, anklagen – und streiten.
Bald verbreitet sich die kritische Tätigkeit wie ein Lauffeuer: „von den klassischen Texten und der Bibel ausgedehnt auf alle Gebiete der Gesellschaft und des Staates“ und „von der Beurteilung der Authentizität von Texten zur Aufklärung schlechthin“ (Röttgers 1982: 655). In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bilden sich funktionale Abteilungen heraus. So unterscheidet Marmontels Enzyklopädie-Artikel Critique eine „Kritik in den Wissenschaften“ von der „Kritik in den freien Künsten oder den schönen Künsten“. Anfang des 19. Jahrhunderts schälen sich schließlich drei wesentliche Bereiche heraus: Neben der Kunstkritik floriert eine „philosophische“ Sphäre als Vernunft- oder Erkenntniskritik, vor allem in deutscher Sprache. Der unmittelbar politische Bereich wiederum heißt gemeinhin Gesellschaftskritik.
Angesichts solcher Auffächerung versuchen die Aufklärer, eine Art begriffliche „Klammer“ zu konstruieren, die alle Bereiche kritischer Tätigkeit jenseits ihrer Differenzen fortan miteinander verbinden soll: Kritik als menschliches Vermögen, Dinge und Hervorbringungen unterscheiden, überprüfen und beurteilen zu können. Dieser Klammer verdanken wir wohl die erwähnte Homonymie.
Kommentar und Kritik
Heute werden auch unterschiedliche hermeneutische Verfahren als Einheit dargestellt und unter Kritik subsumiert. Kommentar ist aber nicht gleich Kritik – mehr noch: Lange Zeit bestand eine unerbittliche Konkurrenz zwischen diesen beiden Sekundärdiskursen um die Hoheit in der Textrezeption.
Der Kommentar hat eine paradoxe Aufgabe. Texte (wie die heiligen Schriften), von denen angenommen wird, dass sie eine zeitlose Wahrheit enthalten, müssen selbst über der Zeit stehen. Da sie aber schließlich schon sprachlich Kinder ihrer jeweiligen Zeit sind und von Generation zu Generation zunehmend dunkle Stellen aufweisen, müssen sie ständig neu verständlich gemacht und in ihrer Funktion legitimiert werden. Der Kommentar hat das In-die-Zeit-Einbetten des betreffenden Textes so zu bewerkstelligen, dass dessen Über-der-Zeit- Stehen nicht beeinträchtigt wird. Dieser Prozess heißt Tradierung, die in der Moderne mitnichten verschwunden ist.
Der Kommentar galt bzw. gilt nicht nur der Exegese heiliger Schriften. Auch profane Texte, die für eine Kultur von zentraler Bedeutung sind, werden durch Kommentar tradiert und legitimiert: die Homer-Exegese in der griechischen Antike, die schier unendlichen Kommentare zu den Texten von Shakespeare oder Goethe, die unzähligen Werkinterpretationen „unzeitgemäßer“ Philosophen wie Nietzsche und Wittgenstein … Die Tradierung bildender und darstellender Kunst geht durch Besprechung und Wertung vonstatten: Gemälde, Installationen, „Positionen“, Tanzperformances, Symphonien, Inszenierungen und Konzerte werden – analog zu Texten – „gelesen“ und in Katalogen, Programmheften oder Opernführern ebenso wie auf den Kultur-Seiten der Tageszeitungen rezensiert (im Wortsinne: „verjüngt“).
Mag die Kritik den Kommentar als herrschendes hermeneutisches Verfahren zeitweilig verdrängt haben, dessen Funktion, die Tradition abzusichern, hat sie indes nicht abgeschafft, sondern übernommen. Ein Konglomerat aus hermeneutischen Diskursen macht sich an die Kunsterzeugungen, bestimmt ihren Marktwert ebenso wie ihre Aufnahme in den Bildungskanon, spricht über deren „stille Wahrheit“, „wahren Kern“, aber auch über deren gesellschaftliche Stellung und Funktion. Da dieser Metadiskurs gemeinhin Kritik genannt wird, bleibt er selbst immun gegen Gesellschaftskritik.
Was den Kommentar und die Kritik inmitten ihrer Rivalität miteinander verbindet, ja sogar eine temporäre Ununterscheidbarkeit zwischen ihnen vortäuscht, ist ihr Verhältnis zu einer Säule des – um mit Michel Foucault zu sprechen – Wissen-Macht-Komplexes: dem Kanon.
Der Wille zum Kanonisieren
„Ein Kanon definiert die Maßstäbe dessen, was als schön, groß und bedeutsam zu gelten hat. Und er tut das, indem er auf Werke verweist, die solche Werte in exemplarischer Weise verkörpern.“ (Assmann 2005: 119)
Der (Bildungs-)Kanon als kultur-hegemoniale Stütze der bestehenden Ordnung ist zweifelsohne ein wesentlicher Faktor in gesellschaftlichen Machtverhältnissen und -kämpfen: Was zu wissen ist, welche Normen für die Bildung relevant sind, vor allem dass es eine Liste von Namen und Werken geben muss, deren auswendige Kenntnis die Voraussetzung des Gebildetseins darstellt – all diese Annahmen halten eine kulturelle Ordnung ebenso aufrecht wie die damit verbundenen politischen und ökonomischen Ordnungen. Wenn allerdings bestehende Namen und Werke durch neue ausgetauscht werden, kann es das Kippen dieser Ordnung bewirken, darum ist auch jeder Kanon ständig umkämpft.
Was einen Gegenstand zum Kunstwerk, eine Tonreihe zur Musik, eine Satzfolge zur Literatur macht, ist ein Machtdispositiv, das wir als „Wille zum Kanonisieren“ bezeichnen könnten. Jeder Kanon kommt durch das Fokussieren von Kommentaren auf bestimmte Hervorbringungen zustande, und die kunstkritischen Diskurse finden im jeweiligen Kanon ihre „Nahrung“ vor. Somit legitimiert Kunstkritik den Kanon und reproduziert sich selbst unentwegt.
Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Natürlich hat Kunstkritik auch eine pädagogisch und bildnerisch wichtige Funktion. Künstlerische Tätigkeit, auch auf Ebene der bloßen „Liebhaberei“, verlangt nach Handwerk, nach mentalen wie manuellen Fertigkeiten, nach einem abrufbaren Wissen – der Erwerb und die Verfeinerung solcher Kompetenzen können nur durch ständiges Unterscheiden, Urteilen und Ausbessern gelingen. Hierin nähert sich Kritik – als didaktisches Mittel – wieder an das, was sie einst war, als Gesellschaftskritik noch fallweise ist und worin sie sich vom Kommentar unterscheidet: Überprüfen und Verändern. Je mehr sich Kunstkritik – im Sinne von George Steiner – als künstlerische Interpretation, Ausführung, entfaltet, desto mehr wird sie wieder zur Kritik.
Literatur:
Adorno, Theodor W. (1971): „Kritik“, in: ders.: Kritik. Kleine Schriften zur Gesellschaft. Frankfurt/M.: 10–19
Assmann, Jan (2005): Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München
Röttgers, Kurt (1982): Artikel „Kritik“, in: O. Brunner / W. Conze / R. Koselleck (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-soziologischen Sprache in Deutschland, Bd. 3. Stuttgart: 651–675
Steiner, George (1990): Von der Gegenwart. Hat unser Sprechen Inhalt? München/Wien
Hakan Gürses
ist Philosoph und Erwachsenenbildner. Weitere Informationen und Publikationen sowie Online-Texte finden Sie auf:

