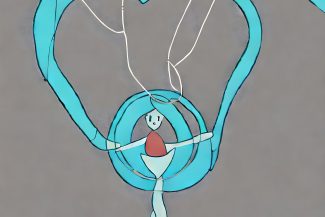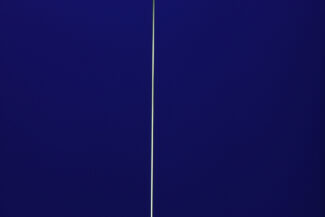KLANG ALS PARTITUR (PEEK Projekt)
Komponist:innen, Musiker:innen, Psychoakustiker:innen und Musikwissenschaftler:innen werden in enger Zusammenarbeit diesen Fragen nachgehen. Um Antworten zu finden werden wir einerseits einen international ausgerichteten Open Call an Komponist:innen lancieren, mit der Aufforderung Kompositionen, die auf einer Audiopartitur basieren, einzusenden, und andererseits ein Labor für kompositorische Experimente mit Audiopartituren und deren Interpretation einrichten. In diesem Labor schaffen wir Raum für Analysen und Debatten hinsichtlich der unterschiedlichen Methoden und Konzepte, die diesen Audiopartituren zugrunde liegen und überprüfen das theoretische Konzept der Mimesis auf seine Anwendbarkeit hinsichtlich der ästhetischen Analyse und Bewertung von Audiopartituren. Um die Wahrnehmung von Rhythmus, Tonhöhe und Klangfarbe bei der Interpretation von Audiopartituren besser zu verstehen werden spezifische Audiopartituren gemeinsam mit Psychoakustiker:innen entwickelt und ihre Interpretation mit psychoakustischen Methoden analysiert.
Das Forschungsprojekt hat zum Ziel, grundlegende Erkenntnisse und vermehrtes Wissen über diesen kompositorischen Ansatz zu gewinnen und in intensivem Austausch von Komponist:innen, Musikwissenschaftler:innen und Psychoakustiker:innen eine interdisziplinäre Analysemethodik zu entwicklen.
Die Hauptverantwortlichen für das Projekt sind Elisabeth Schimana (Komponistin), Susanne Kogler (Musikwissenschaftlerin) und Piotr Majdak (Psychoakustiker).
PHILOSOPHIE IN KUNST : KUNST IN PHILOSOPHIE (PEEK Projekt)
IN DER KÜNSTLERISCHEN FORSCHUNG UND PERFORMANCE PHILOSOPHIE
Forschungskontext
Kunst-basierte-Philosophie (arts-based-philosophy) ist ein innovatives Forschungskonzept, das an der Schnittstelle von Kunst, Philosophie und Wissenschaft angesiedelt ist. In ihm stimmen disziplinübergreifende Forschungskollektive ihre Praktiken untereinander ab, um ihre Forschungsprozesse schließlich in Form von Aufführungen auf der Bühne zu präsentieren und gemeinsam mit der Öffentlichkeit zu teilen.
Zielsetzung
Unser Forschungsprojekt zielt im Speziellen darauf ab, die Bedeutung des *Herzens* (intuitive Vernunft) für künstlerische Forschung und Performance-Philosophie aus einer kulturübergreifenden Perspektive zu untersuchen. Unsere Analysen basieren maßgeblich auf den Konzepten des *Herzens* in den Werken von zwei Künstler-Philosophen: Nietzsches Also sprach Zarathustra und Aurobindos dichterisches Opus magnum Savitri. In diesen Texten haben sie uns einen sensiblen Vorgeschmack davon gegeben, was kunstbasierte Philosophie sein könnte, wenn Kunst & Philosophie ihre Potentiale kreativ gekreuzt haben.
Methoden und Formate
Unsere künstlerischen Forschungsmethoden umfassen folgende Forschungsformate: Art-Labs, ein Notebook, ein mobiles Heart-Lab sowie 12 Field-Performances. In ihnen werden die Stimmen zeitgenössischer Physik, Kardiologie, der Südasienwissenschaft, der Nietzscheforschung und der Künste auf zwei Forschungsfestivals Philosophy On Stage#6-#7 in Szene gesetzt. (BRUT WIEN, ADHISHAKTI Laboratory For Theatre Art Research Indien, SVARAM Music Research Indien). Das Format *field-performance* wurde von Böhler (PI) und Granzer in den letzten 25 Jahren als innovative Methode entwickelt, um philosophische Fragen interdisziplinär und niederschwellig zu präsentieren.
Innovation
Neu an der Konzeption des *Herzens* bei Nietzsche und Aurobindo ist der gemeinsame Anspruch, dass ein *Herz* eine virtuelle Ebene von Möglichkeiten (Potenzen) impliziert. *Herzen* sind auf eine kommende Zukunft ausgerichtet, was sie zu Attraktoren von Möglichkeiten macht, die bereit sind, sich zu manifestieren. In seiner tiefsten Tiefe kümmert sich ein *Herz* folglich um die Manifestation jener Möglichkeiten, die bis jetzt noch nicht realisiert wurden, indem es einen Geschmack (körperlich-gefühltes Empfinden) in uns weckt, der es uns erlaubt, Möglichkeiten vorab zu erspüren; d. h., noch bevor sie materiell aufblitzen, sich räumlich zeigen und „kollabieren“, wie Physiker:innen heute sagen würden. Diese Ausrichtung des „Herzens“ auf virtuelle Potenzen weist auffällige Ähnlichkeiten mit „virtuellen Teilchen“ und „Quanten-Vakuumfluktuationen“ auf, wie sie in zeitgenössischen Strömungen der Philosophie-Physik (Barad, Traxler) verhandelt werden.
Es ist bezeichnend, dass in der indischen Philosophie und Ästhetik ein:e Ästhet:in als sahṛdaya bezeichnet wird; ein Begriff, der wörtlich „jemand, der ein Herz hat“ bedeutet. Als ob ein:e Ästhet:in eine Person wäre, die sich dadurch auszeichnet, dass sie im Einklang mit ihrem *Herzen* denkt, und nicht gegen ihr *Herz*.
Hauptakteure des Projekts
Arno Böhler (PI, Künstler-Philosoph) und unser „core Artistic Research Ensemble“ (cARE): Aurelio (SVARAM), Patrick Beldio (Südasienwissenschaften), Jyoti Dogra (Performance Kunst), Nikolaus Gansterer (Bildende Kunst), Susanne V. Granzer (Schauspiel), Florian Reiners (Schauspiel/Sprache), Sabina Holzer (Tanz), Johannes Kretz (Musik), Stefan Dobner (Kardiologe), Tanja Traxler (Quantenphysik), Yunus Tuncel (Nietzscheforscher), Evi Jägle (PhD), Christoph Müller (PhD).
Kooperierende Institutionen: Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Forschungssitz: ARC-mdw), Adishakti Theater Research (Indien), Svaram Musical Instruments and Research (Indien), BRUT WIEN, Volkstheater Wien, Universität Wien (Institut für Philosophie).
Übersetzt mit Hilfe von DeepL.com (kostenlose Version)
Audio Ghosts (PEEK Projekt)
Das künstlerische Forschungsprojekt AUDIO GHOSTS beschäftigt sich mit Hörillusionen – Höreindrücken, die in der Realität nicht existieren, aber dennoch als akustische Ereignisse wahrgenommen werden. Hörillusionen können für Klanginstallationen bewusst genutzt werden, um sogenannte „Hörgeister“ zu erschaffen. In solchen Klanginstallationen geht es um die künstlerische Gestaltung und Erfahrbarmachung akustischer Umgebungen. In AUDIO GHOSTS wird dabei die räumliche Wirkung vom Hörillusionen einbezogen: Je nach Hörposition werden Klangereignisse unterschiedlich wahrgenommen und animieren zur Gestaltung persönlicher Klangerlebnisse.
Im Zuge des Projektes werden folgende Forschungsfragen bearbeitet:
1) Wie kann Musik unter Einbeziehung von Hörillusionen komponiert werden?
2) Wie können das Wesen und die Wirkung von Hörillusionen mit den Mitteln der künstlerischen Forschung untersucht werden?
3) Inwiefern können Klanginstallationen das bewusste körperliche, sinnliche und emotionale Erleben im Allgemeinen verbessern?
In AUDIO GHOSTS werden künstlerische Forschungsansätze und kompositorische Herangehensweisen fachübergreifend mit wissenschaftlicher Expertise in den Bereichen Signalverarbeitung und Psychoakustik kombiniert. Dadurch kann das Verständnis von Hörillusionen vertieft und einem breiteren Publikum sowohl theoretisch als auch praktisch zugänglich gemacht werden.
Ein speziell entwickeltes Hörlabor wird die Komposition von auf die Projektinhalte zugeschnittenen Klanginstallationen ermöglichen. In wahrnehmungsbezogenen Experimenten wird die Wirkung dieser Kompositionen zusätzlich mithilfe von Fragebögen und Interviews untersucht. Eingeladene Künstler und Künstlerinnen können die Klanginstallationen auf diese Weise systematisch erarbeiten, um ihre Ergebnisse im Rahmen eines Festivals zu präsentieren.
Alle Forschungsaktivitäten werden in einem online Blog dokumentiert und in einem Hörarchiv gesammelt. Die Ergebnisse des Projektes werden auf wissenschaftlichen Tagungen präsentiert und in Fachzeitschriften publiziert.
AUDIO GHOSTS gilt als Leuchtturmprojekt zur Vertiefung des Verständnisses für weitgehend unerforschte Wahrnehmungsbereiche von Klanginstallationen. Das Projekt wird vom Klangforscher Bernhard Gál und der Komponistin Veronika Mayer (Artistic Research Center der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) geleitet. Sie werden aus der psychoakustischen Perspektive von den Wissenschaftlern Piotr Majdak und Florian Pausch (Institut für Schallforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) begleitet und unterstützt. Das Forschungsprojekt wird durch einen wissenschaftlichen Beirat unterstützt, welcher Experten und Expertinnen aus Musik, Klangkunst, Philosophie und den Sozialwissenschaften vereint.
Team: Bernhard Gál (Projektleitung)| Veronika Mayer | Piotr Majdak | Florian Pausch
Nationaler Forschungspartner: Institut für Schallforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften
Laufzeit: Oktober 2023 bis September 2026
Finanzierung: FWF PEEK (AR 774-G)
An Integration of Rap Music and Neue Musik, TIAN FU – AR Pilot
Neue Musik (European art music in the 21st-century). The idea came out of my identity: On the one
hand, I am a composer, who received systematic training of European art music (composition,
piano, and music theory); on the other hand, I am an emcee (rapper), a beat maker, who engaged in
rap music since teenage. Instead of stressing on the opposition between art music and popular
music, this project aims to find intersections and to explore the possibilities of comprehension and
interaction.
In order to avoid the contextual confusion, I restrict the viewshed of my research within the
scope of Chinese Rap and the “Neue Musik” that I understand based on my knowledge system. So,
on this basis, the central questions of my project are: What are the distinctions and commonalities
of the creative artistic practices, representations, appreciations, disseminations and receptions
between the two fields of music? And how do they affect my artistic practices?
To answer the questions above, on one hand, I attempt to integrate the musical materials and
compositional techniques from two fields in my artistic practices. On the other hand, the method of
auto-ethnography will be implemented to discover how the aesthetic decisions are made during the
compositional process based on my identity and knowledge system. Lastly, the feedbacks of my
works from the colleagues and audience will be collected and discussions/talks will be organized in
order to finally establish a dynamic system: creative practices — self-reflection — feedbacks from
“outside world”.
Keywords: rap music, Neue Musik, integration, artistic research, auto-ethnography, creative
practices
Études for live-electronics (PEEK-Projekt)
Abstract:
Wider arts-based research context:
Études for live-electronics is an artistic research project that aims to re-define the western classical music-influenced concept of études, by applying it to the diverse practices in the field of electronic music performance, where most live-electronic practitioners (LEP) are simultaneously instrument developer, interface designer, composer, and performer. Practising études is a fun method to gain skills on acoustic instruments. However, with electronic instruments, the interface and the sound generator are decoupled, interchangeable, and instrument parts can even be driven algorithmically. Thus, the skills required by each LEP are unique, and research on knowledge transfer in electronic music performance is subsequently needed, a shortcoming, that is often discussed in the community for New Interfaces for Musical Expression.
Objectives:
With the overall aim to develop an agile concept of études, we will test the hypothesis that its core element – the encounter with a problem through repetition and slight variation – can be transferred to a multi-culturally driven, collaborative research procedure, that facilitates knowledge exchange through the practice of live-electronic music performance creation. Our goal is to build a community of key agents in the field that will study the acquisition and transference of skills and implement actions to share this knowledge.
Approach:
With cyclically recurring, artistic experiments in collaboration with practitioners from diverse backgrounds, such as sound artist KMRU aka Joseph Kamaru (Kenya), composer Trinh Luong Hue (Vietnam), music technologist Bernt I. Wærstad (Norway) and interaction designer Astrid Bin (UK), we will explore new methods to create skill-derived electronic instruments, historically-informed repertoire and collaborative live-electronic performances. For a multi-cultural perspective, the artistic research team will be in dialog with local music scenes in East Africa, Southeast Asia and Europe, giving public workshops and concerts in collaboration with international partner institutions. From the data collected during these actions, we will formulate a new understanding of études, applicable to live-electronic instruments of the 21st century.
Innovation:
This project will lead to methodological innovations for the development of electronic instruments and related repertoire, represents the first long-term investigation of how LEPs develop embodied knowledge with electronic instruments, and will, furthermore, explore new forms for the preservation of computer music works, by establishing an active musical live-performance practice around them.
Primary staff involved:
The project will run under the supervision of Alex Hofmann, working together with two PhD students at the University of Music and Performing Arts Vienna (mdw), in a strong collaboration with Karlheinz Essl from the Department for Composition (mdw).
Network of national and international cooperations:
- Karlheinz Essl – Department for Composition, Electro-acoustics and Sound Engineering (mdw)
- Bernt Isak Wærstad – Norwegian University for Science and Technology (NO)
- Luong Hue Trinh – composer, performer (VN)
- Joseph Kamaru – sound artist, composer performer (KE)
- Astrid Bin – Bela.io / Ableton Live (DE)
- Andrew McPherson – Queen Mary, University of London (UK)
- Joachim Heintz – Institute for New Music Incontri at the University of Music, Drama and Media Hanover (DE).
- Marko Ciciliani – Institute for Electronic Music and Acoustics (IEM) of the Arts University in Graz (AT)
- Julia Mihály – HfMDK Frankfurt (DE)
- Martin Kaltenbrunner – Tangible Music Lab at the University of Art and Design in Linz (AT)
- Susanne Gerhard – Cultural Programme Office, Goethe-Institute Nairobi (KE)
- Valerie-Ann Tan – Goethe-Institut Singapore (SG)
Confronting Realities. Arbeit an filmischen Autosoziobiografien (PEEK-Projekt)
Das Hauptziel des Projekts ist die künstlerisch-wissenschaftliche Erforschung, Beschreibung und Produktion von filmischen Autosoziobiografien.
Das Projekt ist auf vier Ebenen angelegt: Ebene (1) der autosoziobiografischen Exploration, die „Exploration Groups“ bilden wird – das „Laboratorium der filmischen Autosoziobiografien“ (LAFA). Das Ziel des LAFA ist es, Wege zu suchen und zu erforschen, wie (Auto-)Soziobiographien aus einer kunstbasierten Perspektive zugänglich gemacht sowie kontextualisiert werden können. Die Ebene (2) der filmischen Formate und Techniken beabsichtigt, Narrative und Techniken filmischer Autosoziobiografien zu entwickeln und in filmische Formate zu übersetzen. Ebene (3) der interdisziplinären und theoretischen Kontextualisierung möchte einen fundierten Konnex schaffen zwischen kunstbasierter, theoretischer und interdisziplinärer Forschung über Autosoziobiografien, filmischen Formen und kollaborativen Strategien der Kunstproduktion. Ebene (4) der Reflexion und Evaluation bildet den reflexiven Rahmen rund um das gesamte Projekt. Parallel zu diesen Ebenen entsteht das „Digitale Archiv für filmische Autosoziobiografien“ (DAFA) als Repräsentations- und Dokumentationsplattform für die kontinuierliche Verbreitung, transdisziplinäre Vernetzung und Dokumentation des Projekts.
Bislang wurde das Feld der filmischen Autosoziobiografien weder theoretisch noch praktisch erforscht, obwohl mehrere verwandte filmische Formate existieren. Confronting Realities verspricht daher Pionierarbeit auf diesem Gebiet zu leisten. Darüber hinaus ist in Zeiten eines weltweiten Rechtsrucks, der durch einen Anstieg von Nationalismus und Populismus gekennzeichnet ist, die Frage nach den sozialen Klassen und ihren kulturellen, ökonomischen und politischen Veränderungen sowie deren Einschreibungen in individuelle Biographien wieder besonders aktuell geworden.
Atlas of Smooth Spaces (PEEK-Projekt)
- Theoretischer Rahmen
In diesem künstlerischen Forschungsprojekt untersuchen wir, wie Raumphänomene in audio-korporalen künstlerischen Praktiken notiert, kommuniziert und komponiert werden. Wir bearbeiten diese in vier Disziplinen: Tanz, Rhythmik, Chor.Leiten und Originalton (Film).
Im Gegensatz zu musikalischen, choreografischen und raumtechnischen Notationen sind Raumphänomene in den audio-korporalen Praktiken
eher selten notiert, obwohl der Raum sie verbindet. Die Arbeit an einem Atlas der Raumqualitäten thematisiert diese Lücke. Anstatt nur die metrischen Maße von Räumen ohne den*die Performer*in zu kommunizieren, geht es uns stattdessen um emergente Raumqualitäten von glatten Räumen, die nicht ohne den*die Interpret*in existieren.
- Hypothesen / Forschungsfragen / Zielsetzungen
Wir werden jede der vier Disziplinen miteinander vergleichen und kontrastieren, um zu untersuchen, wie räumliche Phänomene übersetzt, kommuniziert und für die eigene Praxis intensiviert werden. Wir fragen nach den kinetischen Sphären von zwei Performer*innen wenn ein, e dritte, r hinzukommt. Ähnlich dem Dreikörperproblem in der Physik versuchen wir, diese emergenten Phänomene zu beschreiben. Wie können die komplexifizierten räumlichen Interaktionen der Kinesphären notiert werden? Wie gesättigt wird der Raum, wie fragmentiert, wie synchron?
- Ansatz / Methoden
Wir führen Experimente durch, bei denen ein glattes Raumphänomen zunächst zu einem klaren räumlichen Ausdruck destilliert und verdichtet wird. Diesen nennen wir den Null-Raum. Er ist der Ausgangspunkt für unsere Untersuchungen und Experimente, die in einem iterativen Prozess von den Performern und einem Komplexitätsforscher mitgestaltet werden. Wir
sehen eine rekursive Pipeline vor, die die Arbeit in Einzel-, Kollisions- und Koproduktionsmodi unterteilt und arbeiten mit einer flexiblen Rollengestaltung. Die Rollen der Performer*innen, Experimentator*innen und Dokumentator*innen sind nicht an Personen gebunden, um einen Wechsel der Perspektiven zu ermöglichen.
- Innovationsgrad
In Anbetracht der Bedeutung von Räumen in den audio-korporalen Künsten betrachten wir die Entwicklung von transdisziplinären Raumpraktiken und Notationen als unsere wichtigste Innovation. Zweitens glauben wir, dass die
besondere Art der Zusammenarbeit zwischen Performer*innen und einem Komplexitätsforscher zu neuen künstlerischen Methodologien führt. Drittens schaffen wir einen Werkzeugkasten, der auf die intensiven Qualitäten audio-korporaler Raumartikulationen verweist und den disziplinären Bereich der kompositorischen Raumfaktoren für die künstlerische Produktivität vergrößert.
- Kernteam, das an dem Projekt beteiligt ist
Universität für Musik und darstellende Kunst (mdw)
Complexity Science HUB Wien
Alphabetisch: Rose Breuss (Tanz), William Franck (Direct Sound), Johannes Hiemetsberger (Chor.Leiten), Hanne Pilgrim (Rhythmik).
Buch – Knowing in Performing
Knowing in Performing. Artistic Research in Music and the Performing Arts
Der Sammelband ist eine Bestandsaufnahme aktueller Entwicklungen und Überlegungen zu künstlerischer Forschung in der Musik und den darstellenden Künsten. Dreizehn internationale Beiträge loten die Möglichkeiten prozessualer Wissensproduktion unter Berücksichtigung partizipativer und experimenteller Zugänge aus und untersuchen ihre institutionelle Umsetzung. Wie kann Performance in Erkenntnis verwandelt werden? Was bedeutet es, musizierend und performend zu forschen?
Der von Annegret Huber, Doris Ingrisch, Therese Kaufmann, Johannes Kretz, Gesine Schröder und Tasos Zembylas bei transcript herausgegebene Sammelband basiert auf Beiträgen zum Symposium “Knowing in Performing“ im April 2018 sowie zu den gleichnamigen Ringvorlesungen, die von 2018 bis 2020 an der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien stattgefunden haben. Im Rahmen der Buchpräsentation im März 2021 hat die Tänzerin, Choreografin und künstlerisch Forschende Efva Lilja Auszüge aus ihrem den Band eröffnenden Statement zum Stand der künstlerischen Forschung gelesen.
Lesung von Efva Lilja bei der Buchpräsentation von „Knowing in Performing“ DOI: 10.21939/KIP-2021-LILJA
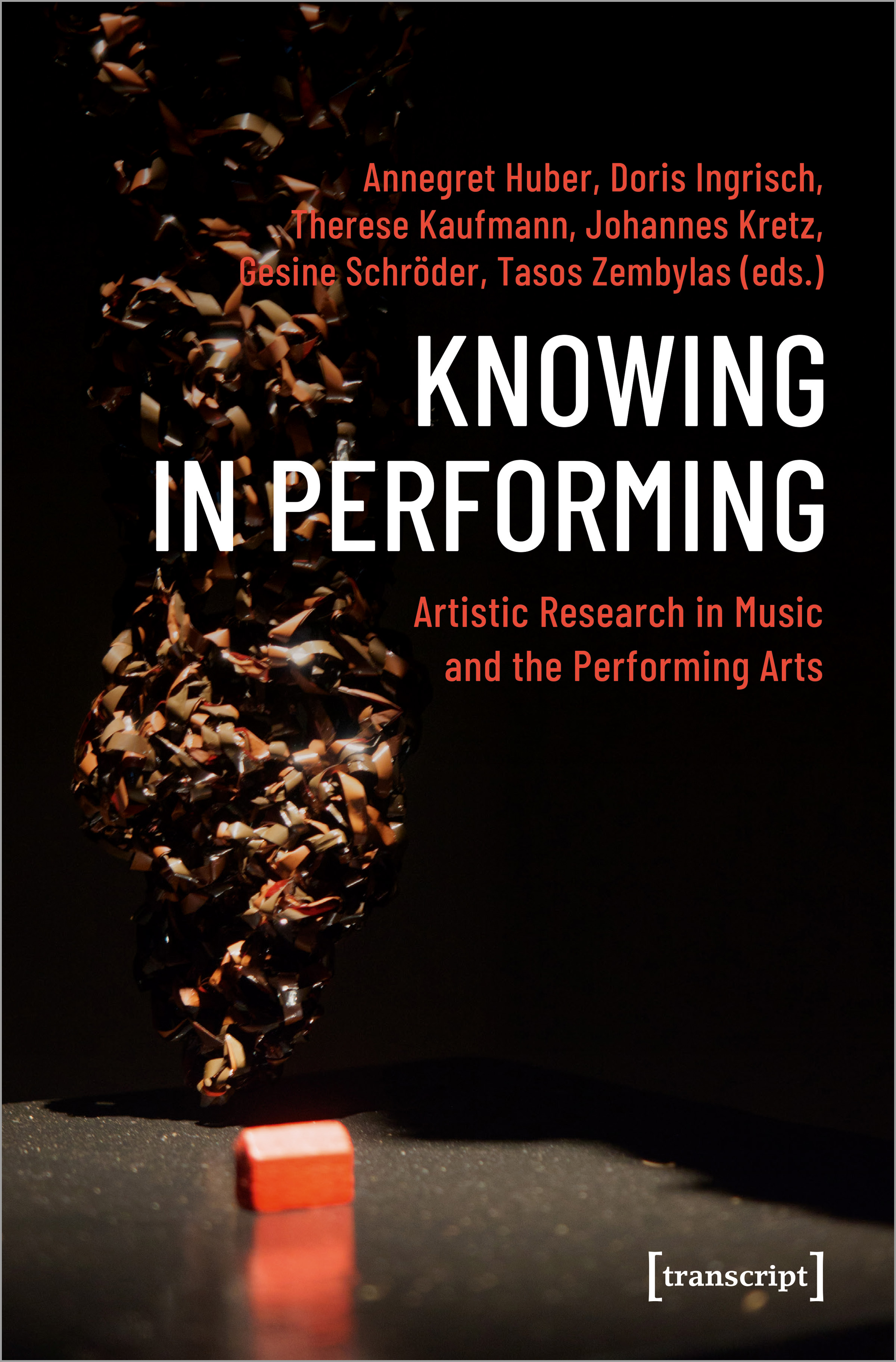
Coverbild: Angelicá Castelló – magnetic room
AR Pilot Call
Ziel des Calls ist die Weiterentwicklung von Praktiken, Methoden und Diskursen der künstlerischen Forschung im Kontext der an der mdw vertretenen künstlerischen Felder und Disziplinen. Neun vorwiegend transdisziplinäre und kollaborative Projekte im Bereich Artistic Research konnten gefördert werden, und einige der Teams stellten bereits Drittmittelanträge im Rahmen des PEEK-Programms des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF). Die Projekte wurden aufgrund ihrer innovativen Forschungsfragen und einer entsprechend ausgewiesenen Methode aus über 20 Einreichungen ausgewählt, wobei die künstlerische Praxis einen zentralen Anteil am Forschungsprozess haben sollte. Neben der Drittmittelantragsstellung war ein weiteres Ziel des Pilot Calls die Dissemination der Ergebnisse anhand öffentlicher Aufführungen, Ausstellungen sowie Publikationen, z. B. im Research Catalogue. Der Research Catalogue ist eine Online-Datenbank, die künstlerische Forschungen sammelt, archiviert, veröffentlicht und ausstellt, betrieben von der Society of Artistic Research (SAR), deren Mitglied die mdw ist. So sollte das aktuell durch die Ringvorlesung Knowing in Performing, die laufenden PEEK-Projekte Rotting Sounds und Creative (Mis)understandings sowie die Vorbereitung des künstlerischen Doktorats auf vielfältige Weise in Entwicklung begriffene Feld der künstlerischen Forschung eine weitere Intensivierung und Weiterentwicklung erfahren.
Weitere Informationen (Forschungsförderung der mdw)
Think Tank
Anstelle des Versuchs einer Definition von AR – was aus verschiedenen Gründen problematisch wäre – weil gerade das Definieren im Sinne eines Setzens von harten Grenzen dem Wesen der AR widerspricht, präsentieren wir hier zusammengefasst eine Sammlung von Charakteristika von bzw. Indizien für AR und kompilieren eine Reihe von Erfahrungen und Standpunkten, die helfen sollen, AR für die MDW konzeptuell besser zu fassbar zu machen.
Think Tank Artistic Research (Dokumentation)