c u r r e n t n e w s
Welcome to winter semester 2025
The Department of Composition Studies and Music Production wishes all staff and students a good start to the semester.
STUDY CONCERT COMPOSITION
// joint study concert of all composition classes
@Klangtheater
(09.01., 19h)
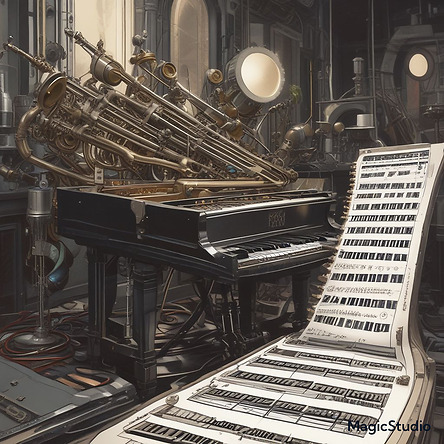
works by:
Luca BORTOLUZZI, Niklas CHROUST, Jonaes ECKENFELS, Micha FAZELI-POUR, Stefan GRIMUS, Jakob HENNEKEN, Soojin JEON, Georg KLÖPFER, Gregor KULLA, Gabriel NEUMAIER, Jan-Eirik OLSEN, João PINTO, Adrian RAVEL
with:
Micha FAZELI-POUR, Zaera GHEORGHE, Boglárka HORVÁTH, Lucia KAPLOWITZ, Sonja OBERKOFLER, Mark SÈRES, Aloisa WETTER, Renee WIRTH, Jingyi ZHAI